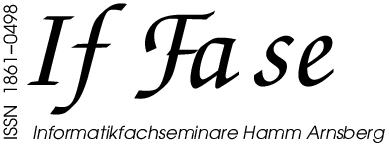
|
In einer Reihe von Artikeln in der If Fase werden nützliche Elemente von LaTeX vorgestellt, die erprobt sind und bei der Arbeit der Informatiklehrerin eingesetzt werden.
Bisher wurden in den vorgelegten neun Teilen der Artikelserie – Ausgaben 0 … 8: rhinodidactics.de/Archiv – Hinweise zur Installation, grundlegenden Arbeitsweisen, Quellen zu Dokumentationen, die Arbeit mit KOMAscript, Hinweise auf PSTricks und als stärker inhaltsbezogene Elemente die Erstellung von Arbeitsblättern, Struktogrammen, Automatengrafen, Elementen von UML und spezielle Bereiche, wie Barcodes und Formularerstellung thematisiert.
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Zitieren. In der gymnasialen Oberstufe erstellen Schülerinnen Facharbeiten – in der zweiten Phase der Lehrerbildung erstellen Referendarinnen Hausarbeiten. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten gibt es viele Möglichkeiten, nach und nach die Qualität der Darstellung von Ergebnissen weiter zu professionalisieren.
Häufig wird durch formale Vorgaben die Darstellung für die o.g. Belegarbeiten detailliert vorgegeben, ohne dass dabei übliche und bekannte Normen Berücksichtigung finden. Dies führt zu Druckerzeugnissen, die Qualitätsansprüchen aus typographischer Sicht nicht standhalten.
Mit LaTeX verfügen Sie über ein Satzsystem, dass professionellen Textsatz – auf der makro- und mikrotypographischen Ebene gewährleistet. Da viele Parameter beim professionellen Textsatz berücksichtigt werden müssen, sollten die Standardeinstellungen möglichst wenig verändert werden. Dennoch ist eine den individuellen Ansprüchen genügende Änderung einzelner Satzparameter hier und da nötig (und möglich). In diesem Artikel soll allerdings ein Element beleuchtet werden, dass beim professionellen Arbeiten immer wieder auftritt und regelmäßig genutzt werden kann: Erstellung und Nutzung von Literaturverzeichnissen.
Bei der folgenden Darstellung gehe ich davon aus, dass die Sammlung
von zu zitierenden Werken in Form einer BibTeX-Datei erstellt wurde. In
den Beispielen wird davon ausgegangen, dass diese Datei den Dateinamen
Komplett.bib hat. Dazu stehen verschieden mächtige Werkzeuge
bereit. Das Format ist inzwischen »in die Jahre« gekommen, allerdings als
gängiges Format immer noch die Form, in der auch über
Datenbanken Rechercheergebnisse ausgegeben oder angezeigt werden können.
Eine Datenbankrecherche für Informatikliteratur illustriert dies:
www.informatik.uni-trier.de/~ley/db
In dem Bildschirmfoto erkennen Sie zwei Datensätze, die fertig
formatiert sind und so in eine bestehende Sammlung mit BibTeX-Datensätzen
eingefügt werden können. Gehen wir davon aus, dass Sie auf diese Art die
notwendigen Datensätze bereits in einer reinen Textdatei gesammelt haben
(die Syntax sollte selbsterklärend sein), so ist nun die Frage zu
beantworten: Wie kommen diese Daten in mein gesetztes Dokument? Dazu
bemüht LaTeX weitere Hilfsmittel: mit der Erfassung der Daten (siehe
Beispiel) ist die Formatierung, die Reihenfolge, die Art der Schreibweise
für die Zitation, etc. nicht festgelegt, so dass Sie
diese Daten durchaus für verschiedene Vorgaben verwenden können. Die Art
der Zitation wird durch Dateien mit der Endung .bst für das
von LaTeX getrennte Programm BibTeX bestimmt. Für Publikationen großer
Verlage, für Tagungsbände, für … liegen die entsprechenden
Formatvorlagen vor. Zu unserem »Glück« trägt bei, dass verschiedene
Formatvorlagen existieren, die eine DIN-gerechte Zitation
ermöglichen.
Sie schreiben in das Dokument an der Stelle, an der sich das Zitat
[ohne abschließendes Satzzeichen(!)] die normalen »Abführungszeichen«,
und geben die Quelle mit
\cite[S.~270]{DBLP:conf/schule/HumbertEFHPRS05} an. Damit
wird beim LaTeX-Durchlauf der zugehörige Verweis in die
.aux-Datei eingefügt. Die Art der Formatierung wird an der
Stelle festgelegt, an der das Literaturverzeichnis eingefügt werden
soll:
\bibliographystyle{natdin}\bibliography{/home/humbert/Komplett}Zunächst ist das Paket natbib in der Präambel zu laden
und ggf. mit \bibpunct{[}{]}{}{a}{}{,~} die Ausgabe im
Dokument anzupassen. Stehen in der BibTeX-Datei URLs, muss das Paket
hyperref geladen werden. Dies bietet darüber hinaus den
Vorteil, dass bei einem mit pdflatex gesetzten Dokument die
Verweise in dem Dokument aktiv zu der jeweiligen Stelle im
Literturverzeichnis führen. Außerdem können URLs auf diese Weise aus dem
PDF-Dokument heraus direkt genutzt werden.
Die DIN-Zitation hat den Vorteil, dass sich die Autorin keine weiteren
Gedanken um die korrekte Ausgabe des Literaturverzeichnisses machen muss.
Allerdings treten durch die DIN-gerechte Zitierweise manchmal unschöne
Effekte an Zeilenenden auf, da die Quelle nicht umgebrochen wird. Um
diesem Zustand abzuhelfen, ist das Paket cite zu
bemühen.
Arbeitsschritte
.aux-Datei)bibtex auf die Datei (ohne Dateiendung => erzeugt
eine Datei mit Endung .bbl)bibtex erstellten Datei)Um den Verweis zu erstellen, wurde dem Eintrag in der BibTeX-Datei
eine Notiz »angeheftet«:
note={\url{https://ddi.uni-wuppertal.de/}
-- gepr{\"u}ft am 1.~Mai 2006}
Dem gesetzten Dokument kann entnommen werden, dass der Eintrag »crossref« aufgelöst und in das Literaturverzeichnis integriert wurde. Sobald mindestens zwei solcher Einträge eine gemeinsame Quelle referenzieren, wird dieses gesondert aufgeführt und beide zeigen auf dieses Dokument. Um all' diese Details muss sich die Autorin keinerlei Gedanken machen.
Quelle für die *.bst (und eine Konfigurationsdatei):
www.haw-hamburg.de/pers/Lorenzen/bibtex