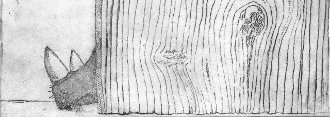27. Februar 2010 – Christian F.
Görlich
Lernwerkstatt
Christian F. Görlich im Gespräch mit Meinert A. Meyer
Interview vom 23.02.2010 über den Entwurf einer Lernwerkstatt (1993)
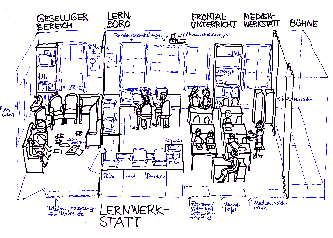
- Christian: Du räumst im Zusammenhang mit Schulreformen
dem Ort des Lehrens und Lernens und seiner architektonischen Gestaltung einen
hohen Stellenwert ein (siehe auch Deine Vorlesung: Lehren und Lernen in
pädagogischen Institutionen o.J.). Warum?
- Meinert: Ich sage den Studenten immer: Unterrichten
heißt kommunizieren, und Kommunikation fängt mit der Sitzordnung an. Ich will
die Studenten dadurch erst einmal dafür sensibilisieren, dass man zum
Beispiel das Ziel, dass die Schüler miteinander diskutieren, nicht mit der
traditionellen Frontalunterrichtssituation schaffen kann. So simpel und
primitiv – wenn Du willst – ist mein Ansatzpunkt. Wenn ich meinen
Gesprächspartner immer nur von hinten sehe, seinen Rücken, kann ich schlecht
mit ihm »kommunizieren«. Die Idee der Entsprechung von unterrichtlicher
Zielsetzung und architektonischer Gestaltung – festgemacht an der
Frontalsitzordnung – kann man natürlich ausbauen und dann fragen, wie
eigentlich das learning environment – um John Deweys Begriff
zu gebrauchen – aussehen muss, wenn man unterschiedliche
Kommunikationsformen anstrebt. Letzteres hat wieder mit der These zu tun,
dass Unterricht wesentlich Kommunikation ist.
- Christian: Du setzt also zunächst bei der Kommunikation
ganz allgemein an; und nach einer Binnendifferenzierung in
Kommunikationssituationen kann es ganz unterschiedliche Lernarrangements
geben?
- Meinert: Ja.
- Christian: In diesem Zusammenhang sprichst du von
»Werkstatt«. Warum »Werkstatt« und z.B. nicht »Akademie« oder »Fabrik«? In
der Zeichnung selbst taucht auch noch der m.E. erläuterungsbedürftige Begriff
des »Lernbüros« auf. Welche spezifischen Konnotationen sind von Dir
beabsichtigt?
- Meinert: Noch einmal eine simple Antwort: Werkstatt ist
die Übersetzung von lat. »officina« (auch: Fabrik; metonymisch: Werkstätte,
Brutstätte, Herd). »Officina« ist ein Schlüsselbegriff bei Johann Amos
Comenius, der von 1592 bis 1670 gelebt hat; Comenius sagt, für das Lernen
brauche man eine »Officina«, und dabei denkt er vermutlich an die
Drucker-Werkstatt, in der Bücher gedruckt und verlegt werden. Comenius hat in
einer berühmtten Analogie das Lehren mit dem Bücher drucken verglichen: Wenn
die Schüler etwas neues erlernen sollen, dann geht das nur so, dass die
Schüler das »aufsaugen«, was der Lehrer vorträgt. So, wie der Buchdrucker das
angefeuchtete Papier mit den Lettern bedruckt. Man mag das heute kritisieren,
wir denken zu allerserst bei einer Lernwerkstatt an selbstreguliertes Lernen.
Trotzdem gilt auch heute, dass das Neue irgendwie in die Köpfe der Lernenden
hinein muss.
Auch der Begriff des »Lernbüros« hat einen historischen Hintergrund, er geht
auf Herwig Blankertz (1927 – 1983) und den nordrhein-westfälischen
Kollegschul-Versuch zurück. Für den berufsbildenden Teil der Kollegschule,
und hier für den kaufmännischen Bereich, hat Frank Achtenhagen den Begriff
»Lernbüro« populär gemacht: eine Lernwerkstatt als simulierte Bürowelt, in
der kaufmännische Transaktionen durchgeführt werden können. Achtenhagen hat
dann auch empirisch nachgewiesen, dass in solchen Lernbüros besser gelernt
wird als im traditionellen Frontalunterricht.
- Christian: Diesen historischen Rückbezug halte ich für
hilfreich; ich muss gestehen, dass ich zunächst nur handwerkliche
Produktionsformen assoziiert hatte. Aber nun zu Deiner Skizze! Wenn der Blick
des Betrachters von links nach rechts durch die Lernwerkstatt gleitet, kann
er beim ersten Hinschauen drei Bereiche unterscheiden: einen geselligen
Bereich, ein Lernbüro – dieses hast Du eben schon angesprochen –
und einen im engeren Sinne konventionell-schulischen Bereich, wiederum
untergliedert in eine dem Frontalunterricht entsprechende Sitzformation, eine
erläuterungsbedürftige Medienwerkstatt und eine Bühne. Neben dem Bedürfnis
nach Klärung der Struktur und der erläuterungsbedürftigen Details stelle ich
mir die Frage, inwieweit diese Anordnung – gleichsam auf auf der Basis
einer anthropologischen Tiefenstruktur – einem klassisch zu nennenden,
unterschiedliche menschliche Fähigkeiten umfassenden Bildungsideal folgen
will?
- Meinert: Ich weiß nicht, ob man eine solche
Tiefenstrukturen in die Lernwerkstatt hinein denken kann. Ich sage einmal,
woran ich gedacht habe: Der Ausgangspunkt war eine so genannte
Fremdsprachen-Lernwerkstatt. Als ich so eine solche Zeichnung wie die oben
abgebildete zum ersten Mal angefertigt habe – so etwa um 1988
–,war es mir für die Fremdsprachen schon lange klar, dass die
Kommunikationsformen, die man sprachmittelnd von einer Sprache und Kultur zur
anderen verwendet, viel komplexer und viel variantenreicher sind, als das,
was traditionell im Fremdsprachenunterricht realisiert wird: das
fragend-erörternde Unterrichtsgespräch, die Übungen, das Textaufsagen etc.
Dann habe ich versucht, diese Kommunikationsformen auszudifferenzieren und
dies hat dann zu drei, vier oder fünf Bereichen geführt, die Du jetzt benannt
hast.
Auch bezüglich der noch nicht besprochenen Teilbereiche kann man wieder mit
historischer Erläuterungen anfangen. Der Ausdruck »geselliger Bereich« geht
zurück auf Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768 – 1834).
Angehörige der Bildungsbürgerschicht haben damals den Salon entdeckt, einen
Bereich, in dem man sitzen und über Gott und die Welt diskutieren kann.
Modern und etwas platt würde man heute von der Möglichkeit zum »small talk«
sprechen. Auch den »small talk« muss mann lernen, man muss ihn kultivieren.
Wenn man zum Beispiel in der Lernwerkstatt Gäste aus fremden Ländern hat,
dann möchte man sich doch auch hinsetzen können, um mit ihnen zu sprechen,
aber – das ist gar nicht so einfach, in der fremden Sprache oder wenn
man auch noch dolmetschen muss! Der »geselliger Bereich« ist also ein
notwendiger Bereich in einer fremdsprachlichen Lernwerkstatt und nicht nur
zur Erholung obenauf.
Mit »Lernbüro« ist dann – wie oben bereits dargestellt – der
berufliche Bereich gemeint. Aber auch die Bühne möchte ich angesichts ihrer
Bedeutung für den Kulturbereich nicht abgewertet wissen. Das Problem mit
diesen beiden Bereichen ist, dass sie eigentlich immer eine viel größere
Lernwerkstatt verlangen, als alltäglich an den Schulen realisiert werden
kann. Man bräuchte eine richtige Bühne mit Ausstattung, nicht irgendwo in der
Schule, zum Beispiel in der Aula, sondern gleich im Lernwerkstattbereich, so
dass man sich gleichsam nur umdrehen muss. Man liest den »Hamlet«. Und dann
kann jemand auf die Bühne steigen, um mal eben den Hamlet zu spielen: »To be
or not to be«. Man muss Kommunikation inszenieren können. Und deshalb braucht
man für die Sprachen auch eine Medienwerkstatt - weil Medien eine besonders
prominente Form der Inszenierung von Lernstoff darstellen.
- Christian: Wir haben uns jetzt der Beschreibung des
Bildes am Beispiel der Fremdsprachenlern genähert. Wenn man sich dem Thema
Kommunikation und Gestaltung der Lernmöglichkeiten von der Schule als ganzer
her annähert, ergeben sich weitere und andere Fragen. Mit Blick auf die
Lebenswirklichkeit der Schüler kritisch nachgefragt: Wo bleiben hier die
naturwissenschaftlichen Fachräume, aber auch Küche und Mensa? Wo ist die
Fahrradwerkstatt? Der Raum für körperliche Ertüchtigung? … Die Liste
kann noch beträchtlich erweitert werden!
- Meinert: Ich habe gelegentlich im Rahmen von
Hausarbeiten Studenten den Auftrag gegeben, die Fremdsprachenlernwerkstatt in
andere Fächer umzuschreiben. Das geht erkennbar gut Dabei zeigt sich, dass es
in gewissen Fächern, den Naturwissenschaften, der Kunst oder dem Sport,
längst Arrangements gibt, die der Idee der Lernwerkstatt entsprechen. Sport
betreibt man in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz, Naturwissenschaften
lernt man im labormäßigem Arrangement; aber auch die die Geschichte oder die
Gesellschaftswissenschaften oder welche Fächer Du hier nennen mögest –
alle haben jeweils ihre speziellen Anforderungen an die räumliche Gestaltung
der Räume als »learning environment«. Wenn ich etwa an Andreas Petrik denke,
der auch zum Kreis der Bildungsgangdidaktiker gehört, und sein Beispiel einer
Dorfgründung im Politikunterricht: da müssen die Schüler ganz allein für sich
soziale und politische Verhaltensweisen simulieren und kultivieren. Jemand in
diesen Simulationsspiel Geld geklaut. Welche Strafen soll der Dieb dann
bekommen? Wie drakonisch darf man strafen? Wo ist das Gefängnis, und wo der
Gerichssaal oder das Rathaus? Der eine Schüler ruft dann: »Kopf ab!« Der
andere sagt, dass sei doch eine Lapalie. Und so weiter. Man braucht ein
ganzes Dorf, zumindest simuliert, um die Funktionsabläufe des menschlichen
Zusammenlebens im Handeln durchschauend zu lernen.
Für das Unterrichsfach Geschichte müsste die Lernwerkstatt noch wieder anders
aussehen. Dabei käme den Medien besondere Bedeutung zu.
- Christian: Mir fiel auf, dass die Zeichnung einen
äußerst erfreulichen Sinn für die alltäglich pragmatischen Rahmenbedingungen
des Lehrens und Lernens zeigt: Etwa die Möglichkeit einer
Fensterverdunkelung, eines Waschbeckens einer Kaffeemaschine usw. Habe ich
etwas übersehen?
- Meinert: Du siehst, wie schnell solche Zeichnungen
veralten. Auch Du hast noch nicht gesehen, dass in dieser Zeichnung noch kein
Hinweis auf das Internet zu finden ist. Eine indirekte Andeutung findet sich
nur in der E-Mail-Anmerkung. Als ich diese Fassung einer Lernwerkstatt
gezeichnet habe, da war der Siegeszug des Internet noch gar zu erahnen. Heute
spielt es aber im Zusammenhang mit den anderen Informationstechnologien die
zentrale Rolle. Das heißt, solche Bilder müssen fortlaufend aktualisiert
werden.
- Christian: Okay, in der Lernwerkstatt nehmen die Medien
einen relativ breiten Raum ein. In dem Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten
der Arbeit am Computer – von Einzelarbeitsplätzen bis zu
fabrikähnlichen Anordnungen – hast Du Dich für die Darstellung eines
Arbeitsplatzes für ein Schülerpaar entschieden. Welches pädagogische Konzept
steht dahinter?
- Meinert: Gedacht ist natürlich daran, dass in diesem
Lernbüro Platz für die ganze Klasse ist. Aber ein Blatt Papier in DIN A4 ist
nicht groß genug - oder man müsste klitzeklein zeichnen. Dabei ist es –
und hier sollte Ludger Humbert in die Überlegungen einbezogen werden –
selbstverständlich, dass man am Computer nicht alleine arbeitet, sondern zu
zweit, weil dies die Kommunikation fördert und auch lerneffektiver ist.
- Christian: Diesen letzten Passus möchte ich gern
unterstreichen. Denn Deine Begründung stützt das Konzept, das Ludger und ich
schon lange in der Seminarausbildung vertreten. Die von dir vorgestellten
neuzeitlichen Medien (Telefon, Kassettengeräte, Radio, Computer, Fernsehen,
Video, etc.) spiegeln dabei übrigens - informationstechnisch betrachtet -
eine Übergangsphase, insofern bei diesen Medien eine Tendenz zur Integration
zu beobachten ist. Das Telefon im uns noch vertrauten Sinne ist dabei
medienhistorisch betrachtet eine Eintagsfliege! Andere Medien sind dagegen
klassisch und fast ahistorisch: die Tafel, die Bühne etc. Daraus leite ich
die medienkritische Frage ab, inwieweit jeweils neue und aktuelle, aber auch
von den Marktinteressen abhängige »Werkzeuge« Eingang in die Lernwerkstatt
finden sollten?
- Meinert: Da gibt es für mich eine klare Antwort. Sie
müssen Eingang in jede Lernwerkstatt finden. Das hat nichts mit Unterwerfung
unter die Medienmafia oder so zu tun. Das, was die gesellschaftliche
Kommunikation bestimmt, muss entsprechend aufgeklärt, reduziert, verständlich
und lernbar gemacht auch in eine Werkstatt hineinkommen. Nimm zum Beispiel
– was hier auf der Zeichnung noch fehlt – die Handys. Wenn man
alltäglichen Frontalunterricht macht, stören Handys; aber im Lernbüro in der
Medienwerkstatt haben sie ihren festen Platz.
Viel wichtiger ist aber, wie ich een schon gesagt habe, die Veränderung
unserer Lebenswelt durch das Internet. Das Internet variiert oder deformiert
– je nachdem, wie man es nimmt – den herkömmlichen
Frontalunterricht. Wenn Sachinformationen beliebig abrufbar sind, verändert
sich auch der Stellenwert des Frontalunterrichts. Er wird aber
selbstverständlich nicht überflüssig.
Das heißt zu Deiner Frage: man braucht für die Legitimation jeder Art von
Unterricht, auch für den in der Lernwerkstatt, eine kritische
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, für die erzogen und unterrichtet
werdenn soll. Ich könnte hierfr den Lehrer meines Lehrers Herwig Blankertz,
Erich Weniger (1884 – 1961), zitieren, der von »Bildungsmächten«
spricht, die in die Schule hineinwirken. Die Lernwerkstatt ist ein fast schon
klassisch zu nennendes Beispiel dafür, dass und wie die Bildungsmächte in die
Schule hineinwirken können. Weniger sagt aber ausdrücklich, dass sie
nur dann hineinwirken dürfen, wenn sie sich in Bildungsstoff
transformieren lassen. Ich sehe hierin übrigens eine Forderung an die
Vertreter der Fachdidaktik der Informatik. Die Informatikdidaktiker müssen
ein Konzept der informatischen Bildung entwickeln, das sich natürlich nicht
auf das Unterrichsfach Informatik beschränken lässt und das die Ausgestaltung
des Medienangebots der Lernwerkstatt (und aller anderen Lehrräume) fundiert.
Die Anforderungen der Bildungsmächte müssen sich für die Bildung der
Heranwachsenden eignen, und nicht etwa nur dazu dasein, Schüler ans Arbeiten
zu bringen oder sie als (billigere, weil kompetentere) Arbeitskräfte
auszubeuten.
- Christian: Zwei letzte Fragen: Aus Deinen Vorlesungen
(hier: Lehren und Lernen in pädagogischen Institutionen. Lehrwerkstätten,
Johann Amos Comenius und John Dewey.– Manuskript o.J.) ist bekannt,
dass Du Dich gern auf den Interlanguage-Forscher Stephen Krashen beziehst,
von dem Du den Begriff »low anxiety atmosphere« übernommen hast. Inwiefern
ist aus Deiner Skizze so eine »low anxiety atmosphere« erkennbar bzw. zu
vermuten?
- Meinert: Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, so
war ich damals extrem nervös, wenn ich auf die Bühne sollte – um
Himmels willen – oder wenn ich im Schulorchester mit meinem Cello
darüber nachdachte, ob ich wohl das tiefe C hinbekomme, das der Musiklehrer
von mir in der richtigen Lautstärke zur richtigen Zeit hören wollte. Oder
nimm den Frontalunterricht! Es ist ja bekannt – von Georg Breitenstein
wieder frisch analysiert – wie gefahrvoll es für Schüler ist, nach
vorne an die Tafel kommen zu müssen, um irgendetwas zu präsentieren. Jede Art
von Kommunikation hat etwas Riskantes an sich und es wäre falsch, dies in
einer Hauptsache-es-macht-Spaß-Atmosphäre verdrängen zu wollen. Man muss die
Ängste beewusst macen, wenn man sie langfristig abauen will. Dies gilt
selbstverständlich auch für den »small talk« im geselligen Bereich meiner
Lernwerkstatt. Es gibt viele Schüler, aber auch erwachsene Leute, die in
solchen Situationen sagen: »Sprich Du lieber mit den Gästen, die kein Deutsch
können« Oder nimm das Lernbüro: »Um Himmels willen, geh Du lieber ans
Telefon, ich habe immer Hemmungen!« »Anxiety« gehört zur Lebenswirklichkeit
dazu, man darf Schule nicht nur als Fun-World organisieren. Aber – die
Lernwerkstatt erlaubt das Probehandeln, und das ist gut so.
- Christian: Das würde bedeuten – wenn ich Dich
richtig verstanden habe – durch die Alltäglichkeit der als belastend
empfundenen Situationen wird man etwas geschult, mit Anxiety umzugehe?
- Meinert: Das ist klar. Zielsetzung für das Lernen in der
Lernwerkstatt ist es – neben vielem anderen – nicht jedes Mal bei
einer Aufgabe Angst zu haben, sondern sich daran zu gewöhnen und zum Beispiel
trotz fremdsprachlicher Defizite erfolgreich zu kommunizieren.
- Christian: Meine zweite abschließende Frage: In der oben
angegebenen Vorlesung sprichst Du auch davon, dass es über Lernwerkstätten
langfristig zu produktiven Kooperationen aller Beteiligten, der Schüler, der
Studierenden, der Lehrer und der Hochschullehrer, kommen kann. Könntest Du
diese für die Lehrerausbildung wichtige Hoffnung zum Abschluss noch einmal
erläutern!
- Meinert: Ich freue mich sehr, dass Uwe Hericks, der
– wie du weißt – mein Assistent gewesen und jetzt nach Marburg
gegangen ist, dort eine universitäre didaktische Lernwerkstatt einrichtet.
Ich selbst habe in Hamburg auch eine Lernwerkstatt gehabt. Wenn so etwas
flächendeckend üblich werden würde und wenn in den Schulen das gleiche
passierte, Fremdsprachenwerkstätten, Kunstwerkstätten, naturwissenschaftliche
Werkstätten, dann hätte man für beide Seiten, Universität und Schule, ein
vertrautes Revier. Wenn die Studierenden in die Schule kommen, sind sie dann
auch wieder in Lernwerkstätten, wenn umgekehrt die Schüler – was
gleichfalls erstrebenswert ist – in die Universität kommen, finden sie
dort auch etwas ihnen schon Bekanntes.
Ebenso wichtig ist deshalb die Frage, wie man langfristig die Ausbildung der
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer gestaltet. Da muss es natürlich viel mehr
Kooperation zwischen der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung geben,
zugleich aber auch zwischen der Schule und der Universität. Aber was man
alles tun muss, um diese Kooperation zu verbessern, ist eine schwierige
Frage, über die unter Berücksichtigung der institutionellen und strukturellen
Rahmenbedingungen nachzudenken ist. Die Klärung dieser Frage dürfte
allerdings den Rahmen eines Gesprächs über Lernwerkstätten sprengen. Man kann
nämlich die Universität als eine riesige Lernwerkstatt betrachten, die
natürlich viel stärker ausdifferenziert ist, als eine Schule es als
Lernwerkstatt je realisieren könnte. Aber an beiden Lernorten gilt,
abgekürzt, dass die Kommunikation mit der Sitzordnung anfängt.
- Christian: Meinert, ich danke Dir! Eine Frage haben wir
allerdings nur indirekt angesprochen: Wie hängt das Thema »Lernwerkstatt« mit
dem weiteren Thema »Bildungsgangdidaktik« zusammen? Wir sollten einen Termin
für ein weiteres Interview ausmachen.