
|
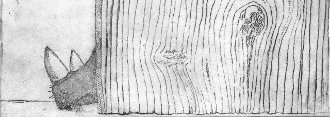
|
In dem vorliegenden Text versuche ich, meine Erfahrungen als Ausbilder und Seminarleiter in der so genannten zweiten Phase der Lehrerbildung zunächst einmal metaphorisch zur Sprache zu bringen. Sprachphilosophisch und in der methodischen Schrittigkeit lehne ich mich dabei an Roman Jacobson an (in: Poesie und Sprachstruktur. Zwei Grundsatzerklärungen. Zürich 1970, S. 37). Im Zusammenhang mit seiner Unterscheidung zwischen einer formalen/wissenschaftlichen, tendenziell kontextfreien Sprache und einer Alltagssprache findet sich ein Plädoyer Jakobsons für die kontextabhängige, auch »natürlich« genannte Alltagsprache. »Es ist die Sprache, welche die Metapher und die Metonymie zulässt, es ist die figurative Sprache. Ohne die figurative Sprache gibt es keine Sprachschöpfung: nicht nur keine poetische Sprachschöpfung, sondern auch keine Möglichkeit einer dynamischen Haltung der Sprache gegenüber, kein Sprechen, das uns erlauben würde, neuen Situationen gerecht zu werden. Die natürliche Sprache, die Sprache, welche Metaphern und Metonymien ermöglicht, ist die notwendige Vorbedingung wissenschaftlicher Entdeckungen. – Ohne diese Sprache lassen sich keine neuen Wege erschließen. Sie ist der Motor der Einbildungskraft. Dem ist beizufügen, dass wir nicht in einen rein und strikt intellektuellen, kognitiven Bereich leben. Gewiss braucht man, um wissenschaftliche Ideen zu formulieren – Formeln. Doch es gibt zahlreiche Lebensphänomene, die nach einer gewissen verbalen Mythologie verlangen.«
Mein treibendes Motiv für die Wiederaufnahme des Themas »Lehrerbildung«
ist ein Unbehagen, das trotz gegenteiliger politischer und amtlicher
Behauptungen – scheinbar durch relativ aktuelle OECD-Berichte gestützt
– verblieben ist. Mit Blick auf Bertold Brechts »Der gute Mensch vom
Sezuan« und der in diesem Theaterstück gestellten Frage nach den Ursachen des
Übels in dieser Welt – individuell moralisch zurechenbar oder
systembedingt? – möchte ich mein Unbehagen an der Lehrerbildung, das
sich für einzelne Betroffene ja durchaus auch als Leiden manifestieren kann,
weniger auf die Akteure als auf die »Fragmentierung« des Systems zurückführen
(vgl. Absatz A).
Bekanntlich versprechen »Defragmentierungsprogramme« die als negativ
angesehenen Folgen einer zu starken »Fragmentierung« zu lindern, wenn nicht
gar zu heilen. Deshalb lautet mein Vorschlag im o.a. explorierenden Sinne von
Jakobson , die Bildungsgangdidaktik von Meinert Meyer und seiner Hamburger
Schule einmal daraufhin zu befragen, inwieweit diese grundsätzlich
diachron/biographisch und an Entwicklungsaufgaben orientierten Überlegungen
Ausgangspunkt für ein überzeugenderes Rahmenkonzept für die Lehrerbildung
– gleichsam ein Defragmentierungsprogramm – sein könnten
(vgl. Absatz B).
Gesellschaftlichen Entwicklungen sind häufig von subkutanen Prozessen
abhängig, die sich den Akteuren erst langsam, manchmal erst im Nachhinein ins
Bewusstsein bringen. Deshalb möchte ich in einem letzten Absatz (C) die Frage
aufwerfen, inwieweit wir uns einem vielleicht epochalen Wechsel der
Wissensordnung gegenüber sehen, der uns über die bloße Reparatur des
bestehenden Systems durch »Defragmentierungsprogramme« zu einem viel
radikaleren Umdenken nötig dürfte.
»Fragmentierung« ist eine Metapher, die dem Geist einer informatisch
geprägten Zeit entspricht. Die Chancen, aber auch die Verengungen, die sich
mit einer solchen Metapher und der Vermählung mit dem Zeitgeist verbinden,
werden kritisch zu überprüfen sein. In der Sache verweist die Metapher auf
einen strukturell seit langem bekannten und diskutierten Sachverhalt: Einer
zunehmend komplexer werdenden Welt entspricht eine zunehmende, sozial
folgenreiche Arbeitsteilung mit der Notwendigkeit einer kompensierenden Moral
oder – wie es bei Emile Durkheim auch heißt – eines
entsprechenden Kollektivbewusstseins. Es handelt sich um ein »klassisches«
Problem in dem Sinne, dass es als Desiderat oder als Problem über – in
diesem Fall – Durkheims Zeit fortlebt, dessen Beschreibung aber heute
nach einer neuen Form verlangt – so Niklas Luhmann in der Einleitung zu
Emile Durkheims »Über die Teilung der sozialen Arbeit« (1930 –
Neuauflage: Frankfurt/M: Suhrkamp 1977, S. 17). Aus meiner Wahrnehmung
sind mindestens zwei Umstände kaum bestreitbar, an denen sich diese
Fragmentierung fest machen lässt: zum einem, dass es sich bei dem Lehrerberuf
um eine hoch komplexe Ansammlung von Anforderungen handelt, zum anderen, dass
die Versuche, dieser Komplexität gerecht zu werden, im Verlaufe der
Entwicklung zu einer starken Fragmentierung geführt haben, die mit Blick auf
die vielleicht nötige und unabweisbare Arbeitsteilung mit der Zeit in eine
starke Kontraproduktivität umzuschlagen droht bzw. umgeschlagen ist. Meine
Wahrnehmung ist dabei durch die schulpolitischen und schulrechtlichen
Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen bestimmt und eingeengt; die Aussagen
dürften aber gleichwohl mit gewissen Einschränkungen verallgemeinerungsfähig
sein.
Die Fragmentierung lässt sich anhand unterschiedlicher/interdependenter
Bereiche festmachen. Da wären zunächst die unterschiedlichen Orte der
Lehrerbildung zu nennen: von der Schule selbst, über die Universitäten, über
die Seminare in der Zweiten Phase bis zu den Fortbildungen whrend der
eigentlichen Berufsausbildung. Angesichts der sich verändernden
gesellschaftlichen Verhältnisse ist weiter auf eine Binnendifferenzierung in
der Lehrerrolle selbst hinzuweisen: ein Lehrer ist nicht nur Unterrichtender
und Erzieher, er soll darüber hinaus diagnostizieren, fördern, evaluieren,
beurteilen, beraten etc.. ein Lehrer hat es mit den unterschiedlichsten
Bezugspersonen zu tun: angefangen beim Hausmeister einer Schule, über das
Kollegium und die Schüler selbst bis zu den Eltern und Interessengruppen.
Hinzu kommt, dass durch eine kurzatmige Bildungspolitik und eine an
Vermarktungsinteressen orientierte Wirtschaft (Schulbuchverlage,
Medienindustrien, etc.) immer wieder andere und neue Erwartungen an den
Lehrerberuf heran getragen werden.
Ich habe es immer als ein Hauptproblem der Ausdifferenzierung der
Ausbildungsorte angesehen, dass die oben angegebenen Subsysteme –
Schule, Universität, Lehrerseminare, Fortbildung – gleichsam in sich
geschlossen mit unterschiedlichen regulierenden Wertsystemen operieren. Lange
Publikationslisten z.B. und die umfangreichen Darstellungen von
Forschungsergebnissen folgen Steuerungsmechanismen, die in der Universität
vielleicht funktional und sinnvoll sein mögen, dem praktizierenden Lehrer in
der Schule mit seiner ständigen Zeitnot ist die in der Folge Marktgesetzen
unterliegende Publikationsflut eher ein kontraproduktives Greuel. Die Logik
der Wissensproduktion in dem einen Subsystem der Wissenschaft entspricht
(vielleicht unabdingbar) nicht dem Rezeptionsbedarf in einem anderen
Referenzsystem wie dem einer Schule.

Fragmentierung der erzeugten Struktur – mit einem »Betriebssystem«, das schlecht konzipiert ist – von Christan Görlich
Entsprechendes gilt übrigens auch für die bürokratische und beschleunigte
Regelungsgenerierung in der staatlichen Bildungsverwaltung. Abhängig von
einer meines Erachtens einseitigen (sich empirischen gebenden)
Politikberatung werden »kreative Gestaltungen« oder ähnliches
verordnungsmäßig über Kaskaden nach unten lediglich durch gereicht statt
wirklich kommuniziert.
Schlichter formuliert möchte ich von Kommunikationsstörungen zwischen den
Subsystemen, mit Blick auf eine verordnende Bildungspolitik in Verbindung mit
einer einseitigen Politikberatung von Kommunikationsverweigerung
sprechen.
Auch die Versuche, diese Fragmentierung gleichsam von unten aufzubrechen,
müssen nach meinen Erfahrungen als gescheitert angesehen werden. So konnte
zum Beispiel im Vorfeld der Reorganisation des Universitätsstudiums nach
Bachelor- und Masterstudiengängen fast von einem Frühling einer neuen
Kooperation zwischen Universität und Seminaren gesprochen werden, der so
manche Hoffnungen weckte. Sogar die Spitzen der Hierarchien wie
Universitätsrektoren bemühten sich, im gemeinsamen Gespräch mit den Seminaren
zukünftige Kooperationsmöglichkeiten zu erkunden. Doch kaum waren in der
Folge die entsprechenden Verordnungen für die Universitäten in der
Landeshauptstadt beschlossen, war es mit diesen Gesprächen vorbei.
Metaphorisch gesprochen hat es neben dem oben gegebenen Beispiel natürlich noch weitere vielfältige Versuche gegeben, durch »Defragmentierungsprogramme« innere Widersprüche aufzuheben und die Ausbildung durch einen gemeinsamen konzeptionellen Rahmen, durch eine gemeinsame Moral oder ein gemeinsames Kollektivbewusstsein im Sinne Durkheims zu befördern. Ich möchte in idealtypischer Absicht nur drei bekannter gewordene »Defragmentierungsprogramme« benennen und in aller Kürze skizzieren:
(2) Die Kritik der Lehrerbildung hat natürlich auch seriöse Reformansätze in der Diskussion hervorgebracht, die sich an einer Optimierung der institutionellen und strukturellen Rahmenbedingungen orientieren. Beispielhaft möchte ich die »Reform der Lehrerbildung in Hamburg« zitieren – herausgegeben von Josef Keuffer und Jürgen Oelkers (Weinheim/Basel:Beltz 2001): »Die Lehrerbildung ist derzeit schwach, weil sie nirgendwo gemeinsame Interessen und Anliegen vertritt. Die Interessen sind zersplittert und gegensätzlich. Thematisch ist die Lehrerbildung abhängig von bildungspolitischen Konjunkturen, die sich mit ganz unterschiedlichen Profiten und Verlusten für die einzelnen Einheiten der Lehrerbildung verbinden« (a.a.O. S. 79). Die Gegensteuerung soll über Zielentscheide, gemeinsame Profile, Kerncurricula für die Teilbereiche mit fortlaufender Abstimmung, über gemeinsame Konfliktbearbeitung und Bewertungen und Darstellung eines Gesamtinteresses – i. S. von Kollektivbewusstsein – erfolgen. Es dürfte eine Nachfrage an Keuffer und Oelkers wert sein, inwiefern sie ihre programmatischen Vorstellungen für Hamburg von 2001 heute im Jahre 2010 realisiert sehen.
In einem bei Computerprogrammen üblichen Bewertungssystem dürften diese beiden »Defragmentierungsansätze« in der Lehrerbildung jedoch noch nicht die volle Sternchenzahl erreichen.
(3a) Die herkömmliche Behandlung von Didaktiken in der Lehrerbildung
Angesichts der fast babylonischen Situation in der Lehrerausbildung hat man
den Weg zu einer neuen Verständigung, zu einem »Kollektivbewusstsein«, auch
in einem gemeinsamen didaktischen Denken gesucht. Doch auch hier zeigt sich
die Wirklichkeit sperrig.
Bei dem Versuch von Ludger Humbert, die Fachdidaktik der Informatik mit der
Bildungsgangdidaktik von Meinert Meyer als allgemeiner Didaktik in ein
Gespräch zu bringen, entstanden Diskussionen, die zu zunächst verblüffenden
und provozierenden Fragen führten, etwa: »Brauchen wir überhaupt eine
Allgemeine Didaktik?«
Wie kann es heute nach so elaboriertenen Diskussionen über das Verhältnis von
Fachdidaktik und allgemeiner Didaktik (Meinert Meyer und Wilfried Plöger,
1994: Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik und Fachunterricht, Beltz) überhaupt
noch zu einer solchen grundsätzlichen Infragestellung kommen? Ist hier
vielleicht noch eine gewisse Bringschuld für die Allgemeine Didaktik zu
vermuten, sich bestimmten Fragestellungen noch konsequenter zu stellen,
eventuell sogar das eigene Konzept zu radikalisieren?
Zur Erwiderung der immerhin von einer Doktorandin aufgeworfenen Frage nach
der Notwendigkeit einer allgemeinen Didaktik seien nur einige weniger Aspekte
benannt – und zwar aus einer Sichtweise, wie ich sie während meiner
Praxis in der Lehrerausbildung immer vertreten habe:
Beobachter und Handelnde erfahren die Wahrnehmung der Lehrerrolle im oben
bereits angedeuteten Sinne als hochkomplex, den Menschen (als biologisches
Wesen) schlicht überfordernde Erwartung, der sie nicht ohne eine
institutionelle Stützung bzw. Kompensation entsprechen können. Diese
Beschreibung sieht sich ganz in der Tradition des anthropologischen Ansatzes
von Arnold Gehlen. Konkret: Wie kann ich die zum Teil widersprüchlichen
Rollenanforderungen des Unterrichtens, Erziehens etc. in einem zunehmend
schwieriger werdenden sozialen Umfeld erfüllen und dabei auch noch meine
Authentizität wahren und meinen persönlichen Stil als Lehrer entwickeln?
Allgemeine Didaktik als Wissenschaft vom Unterricht möchte ich hier als einen Erfolg verheißenden Ansatz verstanden wissen, eine solche Stützung anzubieten, insofern sie diese nun einmal gegebene Komplexität reflektiert, kontrolliert reduziert und so unterrichtliches Handeln wissenschaftlich, d.h. in einem bestimmten Sinne »rational«, planbar und kontrollierbar macht, ohne über diese Reduktion das Ganze des Bildungsauftrags und des institutionellen Rahmens zu vergessen. Das Attribut »rational« bezieht sich im hier gemeinten Sinne auf eine wissenschaftliche Rationalität, wie sie sich in den letzten Jahrhunderten in der westlichen Welt als üblich herausgebildet hat und unter einer globalen Perspektive unserer Gesellschaft gleichsam als charakteristisch zugeordnet wird. Eine solche Relativierung will daran erinnern, dass es auch noch andere, zumindest funktional potentiell gleichwertige Mechanismen der Komplexitätsreduzierung gibt: etwa Alltagswissen, Philosophien, Religionen, Mythen, Metaphern, Riten etc.. Gilt es doch, einer bedenklichen Tendenz zu einer eindimensionalen Wissenschaftsgläubigkeit vorbeugen. Immer geht es nicht nur um empirisch nachweisbare Machbarkeit von Teiloperationen, sondern auch um den Sinn des Ganzen.
Der Hinweis auf das »Ganze« des Bildungsauftrags entspricht der didaktischen Tradition (vgl. Wolfgang Klafki in Meyer/Plöger 1994). Er mahnt an, die rationalen Detailanalysen wieder mit dem Ganzen unserer Existenz, unserer Lebenswelt, in Beziehung zu setzen.
Die Kriterien der Reduktion sind natürlich vom Standpunkt des jeweiligen
Beobachters abhängig. Wohl wissend um die Bedeutung der Kategorie des
Beobachters im gegenwärtigen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen
Diskussionen sehe ich jedoch hier unter dem Einfluss von Biologie und
konstruktivistischer Kognitionswissenschaft eine bedenkliche Verengung des
Problems auf den Beobachter als Einzelnen. Jeder Beobachter agiert jedoch
nicht nur als biologische Einheit oder in sich geschlossenes kognitives
System, sondern zugleich im Rahmen unterscheidbarer Subsysteme mit jeweils
spezifischen Zielsetzungen, Kommunikationsformen und Sinnkonstruktionen.
Schule, Universität, Seminare in der Zweiten Phase, Fortbildung »ticken«
jeweils anders. Die Erkenntnisinteressen, Handlungsintentionen oder
Sinnkonstruktionen von Schülern/Lehrer, von Studenten/Hochschullehrern und
Fortzubildenden variieren. Hier werden kritische Leser handfeste Beispiele
einfordern. Ich meine ganz einfach, dass – während ein Forscher
möglicherweise über eine »gute Schule« nachdenkt – ein konkreter Lehrer
in der Klasse kaum zu solch einer Reflexion kommt, da die Zwänge der Realität
ihn nur an das »Überleben« denken lassen. Je nach Positionierung dürfte also
auch der Stellenwert einer Didaktik – der Allgemeinen Didaktik –
in den verschiedenen Phasen variieren. Das Spektrum der Wertigkeiten dürfte
je nach individueller Befindlichkeit von »überflüssig« bis »unabdingbar«
reichen, wobei man allerdings bei der Beschreibung noch zwischen einer
manifesten und latenten Ebene unterscheiden müsste.
Hinzukommt, dass sich der ja grundsätzlich offene und willige Lehrer einer
scheinbar beliebigen Pluralität von Didaktikangeboten gegenübersieht, die
sich jedoch in einer historischen und wissenschaftstheoretischen
Rekonstruktion beziehungsweise Reflexion als gar nicht so beliebig
darstellen.
Die Geschichte der didaktischen Theorien oder besser die Geschichte des
didaktischen Denkens lässt sich als reaktiv begreifen, insofern sich in
dieser Geschichte die jeweiligen Veränderungen von Jugend und Gesellschaft,
die sich daraus ergebende Kritik an Unterricht und die jeweils neuen
Leitbilder von Schule spiegeln. In Korrespondenz sind die jeweils
entsprechend variierenden erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen
Grundkonzeptionen mitzudenken. (vgl. Friedrich Paulsen, Geschichte des
gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang
des Mittelalters bis zur Gegenwart.- Berlin : de Gruyter, 1965. Nachdruck der
3. erweiterten Auflage von 1921; Eckard König/Peter Zedler: Theorien der
Erziehungswissenschaft. Einführung in Grundlagen, Methoden und praktische
Konsequenzen.- Weinheim: Beltz 1998). Als Beispiel möchte ich darauf
verweisen, dass es nicht nur einen theoretischen Unterschied macht, ob ich
Erziehungswissenschaften mit einem systemtheoretischen oder einem durch die
Frankfurter Schule geprägten Ansatz betreibe. Als Problem habe ich in der
Lehrerausbildung erfahren, dass diese didaktischen Ansätze zwar als
Ausbildungsinhalte neben anderem behandelt wurden, aber höchstens ansatzweise
für die Ausbildung als Ganzes konstitutiv waren. Dies änderte sich für mich
in der Auseinandersetzung mit der Bildungsgangdidaktik.
(3b) Bildungsgangdidaktik reconsidered – ein gemeinsamer
konzeptioneller Rahmen für die Lehrerausbildung?
Der Bildungsgangdidaktik kommt in der skizzierten scheinbaren Pluralität der
Didaktiken meines Erachtens eine besondere Rolle zu. Der Kern der
Bildungsgangdidaktik ist für mich, dass sie sich am sich bildenden Menschen
– in seinem Werden – orientiert, einen Menschen, der in der
Vermittlung von biografisch Gewordenen und auf der Tagesordnung stehenden
Anforderungen über Entwicklungsaufgaben sein Leben zu gestalten sucht.
Bildungsgangdidaktik stellt den Wandel und Generationenwechsel als solches
selbst ins Zentrum ihrer Reflexion.
Dabei wäre zu überlegen, inwieweit die ontogenetische Perspektive durch eine
phylogenetische ergänzt werden könnte. Habermas und Eder haben es meines
Erachtens plausibel vorgemacht, wie man die Beschreibung der individuellen
moralischen Entwicklung in Anlehnung an Kohlberg zu einer Beschreibung der
gesellschaftlichen moralischen Entwicklung ausweiten könnte.
Die Bildungsgangdidaktik bietet meines Erachtens mit ihren begrifflichen
Instrumentarien die Chance, dem oben bezeichneten Auseinanderdriften der
Subsysteme von Schule, Universität und Fortbildung entgegenzuwirken und den
phasenübergreifenden kategorialen Rahmen für die eine gemeinsame Aufgabe von
Erziehung und Bildung bereitzustellen.
Dazu wird es nötig sein, nicht nur von der Bildungsgangdidaktik als
solcher zu sprechen, sondern eine »Perspektivierung« der Inhalte und
Verfahren vorzunehmen, differenziert und spezifisch nach der Interessenlage
der jeweiligen Beobachter in den verschiedenen Subsystemen, die sich
ihrerseits wiederum weiter untergliedern lassen.
Zur Verdeutlichung möchte ich an einem Beispiel eines Buchprojektes von
Thomas Metzinger darlegen, in welche Richtung die Überlegungen laufen
müssten. Thomas Metzinger hat für einen Grundkurs »Philosophie des Geistes«
drei Bände vorgelegt (Paderborn: mentis 2009f), in dem die Studienmaterialien
differenziert nach Bachelor- und Masterstudiengang und
Promotionsinteressenten vorliegen werden. Ich möchte jetzt nicht die
unterschiedlichen Niveaus der Anforderungen weiter beschreiben, geschweige
denn beurteilen. Sicher wird man hier darüber streiten können, ob sich das
Niveau des Masterstudienganges durch die Einbeziehung englischsprachlicher
Literatur definiert. Inhaltlich bleibt hier sicher einiges zu klären. Aber
das Buchprojekt gibt eine spezifische Fragestellung vor, der sich auch die
Bildungsgangdidaktik auf Zeit wohl kaum entziehen kann. Im Anschluss an Uwe
Hericks Ansätze zu einer Typologie der Entwicklungsaufgaben für angehende
Lehrer nenne ich nur einige Fragen gleichsam als Vorarbeiten für eine noch zu
entwickelnde Heuristik:
Bei aller Fragmentierung ist allen Teilen des Lehrerausbildungssystems
eines gemeinsam, dass sie Wissen in Form von Theorien, Erfahrungen etc.
erzeugen. Aber gerade hier scheinen sich nach den bedeutenden
Epochenschwellen der Erfindung der Schrift und der Etablierung der
Buchdruckkunst gegenwärtig fundamentale Veränderungen im Sinne einer neuen
Wissensordnung anzubahnen. Dabei ist unter Wissensordnung nicht nur ein
kognitives Sortiersystem zu verstehen, sondern eine Ordnung in dem Sinne, wie
wir von Rechtsordnung oder Wirtschaftsordnung sprechen. Worin liegt das Neue
und Brisante in unserer Situation? Eine Antwort kann mit Blick auf die hier
gebotenen Kürze nur angedeutet werden. Wissenschaftliches Wissen erhält
gegenwärtig eine größere Bedeutung als je zuvor (vgl. Peter Weingart, Martin
Carrier, Wolfgang Krohn: Nachrichten aus der Wissensgesellschaft. Analysen
zur Veränderung der Wissenschaft.- Weilerswist: Velbück 2007). » Wenn immer
sich ein Problem stellt – ist Fasten ungesund? Macht zu viel Fernsehen
dumm? Vererbt sich schlechter Charakter? - verlassen wir uns bei dessen
Lösung nicht mehr auf das Alltagswissen. Vielmehr werden Experten zurate
gezogen, und wenn diese auch nichts wissen, wird ein Forschungsprojekt
aufgelegt. Mehr noch: eine Vielzahl von Problemen, mit denen sich die
Menschen in modernen Gesellschaften beschäftigen – die Veränderung des
Klimas, der Abbau der Ozonschicht, die Strahlenbelastung durch Mobiltelefone
und Hochspannungsleitungen, die Übertragbarkeit der Vogelgrippe auf den
Menschen – sind erst durch die Wissenschaft aufgedeckt worden (Weingart
u.a. a.a.O. S. 7). Die gegenwärtige Gesellschaft wird also dadurch
charakterisiert, dass das Alltagswissen, auf dass sich die Menschen bisher
verlassen haben, zunehmend durch wissenschaftliches Wissen ersetzt wird. Es
dürfte nicht schwer fallen, dass oben angegebene Zitat auf die
Erziehungswissenschaften und Fragen der Schule zuzuspitzen.
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Praxis des Lehrerberufs und
das Ausbildungssystem?
Bildhafte Vergleiche unterliegen immer der Gefahr, überdehnt zu werden.
Gleichwohl sei abschließend ein Blick darauf gerichtet, was die Zunft zum
Thema Fragmentierung bzw. Defragmentierung zu sagen hat. In Wikipedia können
wir nachlesen, dass Fragmentierung die verstreute Speicherung von logisch
zusammengehörigen Datenblöcken des Dateisystems auf einem Datenträger meint
– mit der Folge relativ hoher Zugriffszeiten und einer spürbaren
Verlangsamung der Lese- und Schreibvorgänge. Defragmentierung kann
demgegenüber den sequentiellen Zugriff mitunter deutlich – also nicht
immer – beschleunigen und damit die Arbeitsgeschwindigkeit des gesamten
Systems erhöhen. Die Autoren der Wikipedia weisen daraufhin, dass es
erhebliche Unterschiede bei der Datenspeicherung und dabei im Ausmaß der
Fragmentierung gibt, je nachdem ob Linux, Mac OS X oder Window als
Betriebssystem eingesetzt werden (vgl. is.gd/9SUXV – aber
auch die Diskussion um den Artikel). So werden wir auch in der Organisation
der gesellschaftlichen Arbeit immer mit gewissen Fragmentierungen rechnen
müssen; aber wir haben es in der Hand, durch eine entsprechende Wahl des
Systems die kontraproduktiven Kosten zu minimalisieren. Jedoch sind Zweifel
angebracht. Wie sollte es einer Landesregierung gelingen, das hoch komplexe
System der Lehrerbildung auf ein fragmentierungsresistenteres System
umzustellen, wenn es ihr noch nicht einmal gelingt, die für Regierung und
Verwaltung unabdingbaren Systeme auf Open Source umzustellen?