
|
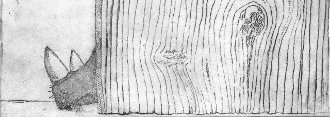
|
Ch. Görlich:
Es ist für Außenstehende sicher hilfreich, wenn Sie, Herr Professor Keuffer,
und Sie, Herr Dr. Kroeger, sich vorweg als Personen und in Ihrer Funktion
hier am Bielefelder Oberstufen-Kolleg vorstellen und etwas zu dem Preis
sagen: von wem wurde er wofür gestiftet und welche Konsequenzen hat der
Preis, den Sie erhalten haben, für das Oberstufen-Kolleg.
H. Kroeger:
Ich arbeite seit 1976 hier am Oberstufen-Kolleg – also schon sehr, sehr
lange. Damals kam ich von der Universität Marburg, wo ich vorher 10 Jahre
studiert und an der Universität auch als Lehrbeauftragter und
Dozentenvertreter gearbeitet habe. Ich bin kein ausgebildeter Lehrer mit dem
Zweiten Staatsexamen. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass ich so
viele Jahre an einer Schule in Nordrhein-Westfalen tätig sein und sogar
Abiturprüfungen nicht nur durchführen, sondern auch als Schulleiter
beaufsichtigen konnte. Dem Land hat es Riesenprobleme gemacht, jemanden ohne
Zweites Staatsexamen in dieser Position zu belassen.
Wir hatten damals am Oberstufen-Kolleg bewusst eine Mischung aus Leuten, die zur Hälfte von der Hochschule kommen sollten, um den universitären Grundstudienteil in Lehre und Forschung abzudecken, und zur anderen Hälfte Lehrer sein sollten. Ich war einer von der Universität, der hier mit den Grundstudienteil übernehmen sollte. Ich war, nachdem ich nach Bielefeld gekommen bin, sehr schnell stellvertretender wissenschaftlicher Leiter neben Hartmut von Hentig, von 1977-79 und dann später noch einmal geworden. Dann bin ich auch schon einmal von 1983-88 Kollegleiter gewesen – ungleich jünger als jetzt. Hinter meiner Berufslaufbahn verbirgt sich das von uns sehr geschätzte Prinzip, dass es gut ist, Leitungsämter auf Zeit wahrzunehmen, weil dies ermöglicht, eine andere Art von Energie für eine begrenzte Zeit freizumachen. Man ist dann eben fünf Jahre oder noch einmal fünf Jahre sehr engagiert in seinem Amt und tritt danach wieder in das normale Lehramt zurück. Zugleich schafft es auch mehr Akzeptanz, weil es in der Institution viel mehr Leute gibt, die befristet Leitungserfahrungen gemacht haben und ganz gut wissen, wie so ein Amt aussieht, wenn man es denn hat.
Ch. Görlich:
Gibt es diese Befristung heute auch noch oder wieder?
H. Kroeger:
Heute bin ich noch einmal für 2 x 5 Jahre als Kollegleiter gewählt, weil es
vorübergehend ein von der CDU-Landesregierung erlassenes Schulgesetz gab,
wonach Schulleiter auch in Nordrhein-Westfalen zunächst für fünf Jahre, dann
noch einmal für fünf Jahre verlängert, ernannt werden konnten. Dann erst soll
die Ernennung auf Lebenszeit erfolgen. Ich bin nach diesem Modus auf fünf und
dann noch einmal auf fünf Jahre ernannt worden. Inzwischen haben das
Bundesverwaltungs- und das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das
nicht legal ist. Insofern bin ich wahrscheinlich ein Unikat in
Nordrhein-Westfalen. Mein jetziges Leitungsamt mache ich seit 2004 fast
zeitgleich zusammen mit Josef Keuffer. Meine Fachkompetenz ist hauptsächlich
Deutsch, Germanistik/Deutsch, ein weiteres Fach ist Evangelische Theologie.
Dieses habe ich aber bisher nicht richtig unterrichtet.
Ich komme zur Frage nach dem deutschen Schulpreis. Der deutsche Schulpreis ist seit 2006 vergeben worden. Er wird hauptsächlich von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof Stiftung, einer Partnerstiftung getragen, finanziert und organisiert. Es ist ein Preis, mit dem in Deutschland anfangs fünf, inzwischen sieben Schulen jedes Jahr eine Auszeichnung nach bestimmten Kategorien bekommen, die jeweils auch schon in der Bewerbung berücksichtigt sein müssen. Eine Kategorie ist Leistung, eine andere Verantwortung, demokratische Formen des Zusammenlebens und so weiter. Zu all diesen Kategorien kann man eine Bewerbung an die Schulpreisjury schicken. Die Bewerbungen müssen immer einen sehr begrenzten Umfang haben, weil sich viele Schulen bewerben und die Jury natürlich nicht so viel lesen kann – also 10 Seiten nur für eine Bewerbung. Wir hatten uns schon beim ersten Schulpreis beworbent, weil wir dachten, dass wir doch eine ganz gute Schule sind. Sollten wir den Schulpreis bekommen, würde uns das vielleicht in vielen Schwierigkeiten, die wir vor allem mit der Politik hatten, unterstützen und uns einen absichernden Schwung geben. Beim ersten Mal (2006) sind wir nicht in die engste Runde gekommen; wir waren aber unter den besten 50 Schulen. Wir hatten damals – wie ich finde – einen sehr schönen Text geschrieben, der literarische Qualität hatte. Es ging um einen guten Geist, der hier durch das Oberstufen-Kolleg ging und bei allen möglichen Situationen Beobachtungen machte.
Es ist natürlich so, dass wir uns als Versuchsschule immer in einem besonderen Status befinden und dass die Jury des Deutschen Schulpreises vermutlich sehr wohl abgewogen hat, inwieweit man eine Versuchsschule mit besonderen Rahmenbedingungen überhaupt in die Konkurrenz mit anderen Schulen einbeziehen sollte. Wir haben dennoch im letzten Jahr aufgrund einer Initiative eines Mitarbeiters der Wissenschaftlichen Einrichtung einen neuen Anlauf unternommen. Es ist ziemlich aufwändig, zunächst einen guten kurzen Text zu schreiben und alle möglichen Begleitmaterialien bereitzustellen. Angesichts des fertigen Textes waren wir dann aber selbst erstaunt, was wir da als Summe auf 10 Seiten in dieser sprachlichen Genauigkeit als Qualität festhalten konnten. Deshalb finden wir den Text auch intern ganz hilfreich.
Es war für uns schön und überraschend, dass wir im Laufe des Jahres 2009 zu den besten 50 gehörten und dann unter die besten 20 Schulen kamen. Die besten 20 Schulen werden alle von Mitgliedern der Jury besucht; wir hatten am 8./9. Februar 2010 eine Teilgruppe der Jury des deutschen Schulpreises hier in Bielefeld zu Besuch. Unter anderen war Professor Manfred Prenzel aus München mit dabei, also ein Erziehungswissenschaftler, von dem wir vorher wussten, dass er nicht gerade ein großer Anhänger des Oberstufen-Kollegs und der Laborschule ist. Auch Erika Risse war dabei, die wir als Peer-Review-Mitarbeiterin gut kennen, und Herr von der Gathen von der Dortmunder Preisträgerschule und Herr Rösch von der Bosch Stiftung.
Das waren dann zwei spannende Besuchstage hier; denn jetzt kam es auf alles an. Nach dem Besuch haben wir zunächst gar nichts mehr erfahren, außer dass wir unter die besten 15 Schulen gekommen sind. Diese 15 Schulen wurden alle zum 9. Juni 2010 in die Elisabeth-Kirche nach Berlin eingeladen, und dort wurde dann der Deutsche Schulpreis verliehen – in Anwesenheit der Bundeskanzlerin. Ja, das war dann für uns schon wichtig und toll und ein großes Erlebnis, diesen Schulpreis zu bekommen. Für uns ist er eine Anerkennung für das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschafft haben. Wir haben am Oberstufen-Kolleg ja doch erhebliche Änderungen gestalten müssen, – und das sozusagen immer am lebenden Herzen. Das ganze System umzustellen, allein von vier auf drei Jahre Oberstufe, das war schon sehr aufwändig. Wichtiger ist mir persönlich aber, dass wir damit für das Oberstufen-Kolleg sagen können, dass vorerst in Existenzfragen der Versuchsschule Ruhe sein sollte und dass kein Ministerium in den nächsten fünf Jahren sagen dürfte: das Oberstufen-Kolleg wollen wir jetzt nicht mehr.
M. Meyer:
Es ist natürlich traumhaft schön, dass sich der Preis gerade auf Leistung
gründet. Denn das Ministeriums bezieht sich in der Regel, wenn es das
Oberstufen-Kolleg mit Erlassen bedrängt, auf die Leistung bzw.auf befürchtete
zu geringe Leistungen der Kollegiaten!
H. Kroeger:
Ich muss an dieser Stelle noch einmal hervorheben, dass die
Robert-Bosch-Stiftung und deren Mitarbeiter, vor allem Herr Rösch, sich nach
meinem Eindruck wirklich mit diesem Schulpreis außerordentlich engagieren und
ernsthaft um eine Verbesserung des deutschen Schulsystems bemühen. Fünf
Schulen werden mit einem Hauptpreis und zwei mit Nebenpreisen ausgezeichnet.
Die Stiftungen veranstalten mit den Preisträgern eine Fülle von Tagungen,
Begegnungen, Schüler- und Exzellenzforen. Daneben gibt es wechselseitige
Einladungen unter Einbeziehung anderer Schulen. Das Engagement der
Mitarbeiter der Stiftungen geht dabei weit über das hinaus, was eine normale
Industrie-Stiftung machen würde. Das beeindruckt mich – wirklich.
Entsprechendes empfinde ich beim Schulverbund »Blick über den Zaun«. Ich merke, dass da wirklich etwas in Bewegung kommt, weil die ausgewählten Schulen nicht nur mit so einem Preis ausgezeichnet werden, sondern als Preisträger mit anderen Schulen die deutsche Schullandschaft weiter entwickeln und verbessern helfen können. Insofern passt der Preis auch für die besuchten Schulen besonders gut. Denn das ist der Auftrag an uns, dass wir uns in die Debatte um die gute Schule und um die Verbesserung von Schule einbringen. Das tun wir im Moment, stark gefördert in der Akademie des Deutschen Schulpreises – so heißt die Dachorganisation, in der wir jetzt für fünf Jahre Mitglied sind – und auch beim »Blick über den Zaun« und bei vielen anderen Dingen, die teilweise auch mit der wissenschaftlichen Einrichtung Oberstufen-Kolleg zusammenhängen. Da haben wir viel zu tun mit all diesem gegenseitige Austausch. (Der Preis hat uns übrigens 25.000 € eingebracht, die wir bisher noch nicht ausgegeben haben.)
M. Meyer:
Ist das Preisgeld an die Verbesserung der Unterrichtsqualität oder Ähnliches
gebunden oder dürft Ihr davon auch – sagen wir einmal – nach
London fahren und den Erfolg dort feiern?
H. Kroeger:
Ich habe das Geld auf ein von mir privat eingerichtete Konto überwiesen
bekommen. Wir können damit alles machen. Im Moment könnte ich als Schulleiter
also auch jeglichen Missbrauch damit treiben, aber ich werde mich hüten.
Ch. Görlich:
Vielen Dank, Herr Kroeger! Sie werden verstehen, dass ich bei meiner eigenen
beruflichen Vergangenheit das Lob des Stiftungswesens natürlich auch als
Kritik an konventionellen Schulaufsichtsstrukturen verstehe. Sind Sie damit
einverstanden, dass wir jetzt zur Person und Funktion von Herrn Keuffer
übergehen?
J. Keuffer:
Ich arbeite seit 2004 in Bielefeld, also jetzt seit genau sieben Jahren, als
Wissenschaftlicher Leiter des Oberstufen-Kollegs und zugleich als
Schulpädagoge in der Arbeitsgruppe 4 der Fakultät für Erziehungswissenschaft
der Universität Bielefeld. Diese doppelte Funktion hatte Ludwig Huber, mein
Vorgänger, auch schon, und auch Hartmut von Hentig.
Als ich hierher gekommen bin, war das für mich der Einstieg in eine besondere Tradition; zugleich war ich aber der erste Wissenschaftliche Leiter, der kein direkter Schüler von Hartmut von Hentig war. Ich stamme eher aus der Linie von Meinert Meyer und Herwig Blankertz und damit in gewisser Weise aus der »Konkurrenzlinie«.
J. Keuffer:
Die Philosophie von Blankertz bestand nicht so sehr darin, als Ausgangspunkt
für die Veränderung des Schulsystems eine Versuchsschule zu nehmen, sondern
die Entwicklung einer breiten Anzahl bestehender Schulen. Nordrhein-Westfalen
hat 24 Kollegschulen mit der Maßgabe eingerichtet, darüber das Schulsystem zu
verbessern. Hartmut von Hentig hat zwei Versuchsschulen gegründet, die
Laborschule und das Oberstufen-Kolleg. Auch er wollte natürlich von dort aus
die Schullandschaft verändern. Diese Ambitionen haben sich in ihrer großen
Perspektive aber nicht realisieren lassen. Das kann/muss man heute sagen; das
gilt für beide Reformer gleichermaßen. Die Ambitionen sind das eine, die
Realität das andere. Dass die Ambitionen weit reichten und dass man im
Endeffekt doch auch eine Menge erreicht hat, sei daher unbestritten. Hartmut
v. Hentig wollte das deutsche Abitur abschaffen. Das ist ihm nicht geglückt
– man muss es so sehen. Auch Herwig Blankertz wollte allgemeine und
berufliche Bildung zusammenführen. Das ist ihm auch nicht geglückt. Trotz
alledem haben beide ihren großen Stellenwert, nicht nur in den
Erziehungswissenschaften, sondern darüber hinaus im Schulsystem.
Es war für den Nachfolger von Hartmut von Hentig nicht ganz einfach, in diese schwierige Situation im Spannungsfeld von Ambition und Realität die Arbeit aufzunehmen. Das Haus war mitten im Umstellungsprozess, als ich hierher gekommen bin. Ich habe meine Aufgabe dabei nicht als »Bildungsphilosoph« verstanden, nicht in Ergänzung, Erwiderung oder wie auch immer zu Hartmut von Hentig, sondern zunächst einmal in der Fortführung der Verwaltung des Hauses, in der Sicherstellung der Ressourcen, in deren Weiterentwicklung, damit das Haus auch weiter arbeiten konnte.
Es gab zwischendurch heftige Krisen. Wir mussten davon ausgehen, dass die Landesregierung beabsichtigte, das Haus zu schließen. Da haben wir gemeinsam – sowohl die Versuchsschule als auch die Wissenschaftliche Einrichtung – gekämpft, dass das nicht passiert, und wir sind erfolgreich gewesen. Das bestätigt uns – denke ich – in unserem Vorgehen.
Als ich hierher gekommen bin, gab es noch keine Trennung von Versuchsschule und wissenschaftlicher Einrichtung. Sie bildeten laut Satzung des Kollegs eine »Einheit«. Alle Mitarbeiter im Haus waren »wissenschaftliche Mitarbeiter«. Wir haben dann gemeinsam überlegt – angeregt über das Ministerium und beraten durch den Beirat – was man tun kann. Ich habe dann 2004/5 ein Peer-Review-Verfahren angedacht, das wir auch umgesetzt haben. Jürgen Oelkers und seine Kommission haben ein Gutachten erstellt, das zunächst im Hause nicht sehr gut angekommen ist, weil es weitere Entwicklungen anmahnte, die man zunächst nicht unbedingt akzeptiert hat. Es gab so für ein Jahr heftige Auseinandersetzungen zu der Frage, wie sich das Oberstufen-Kolleg weiter entwickeln sollte. Da standen einige Dinge im Gutachten, von denen ich glaubte und auch heute noch glaube, dass sie gut für das Haus gewesen sind. Es gab aber auch einige Punkte, zum Beispiel was die Fachdidaktik und die Basiskurse angeht, wo die Kommission normativ etwas in ihr Gutachten hineingeschrieben hat, was das Haus anders sah und was ich aus der rückblickenden Perspektive weiterhin kritisch sehe.
Diese Punkte haben wir letztendlich auch nicht angenommen. Wir haben die Weiterentwicklung der Basiskurse so betrieben, wie das Haus sie angedacht hatte. Und das war gegen den Mainstream der Fachdidaktik. Bezüglich dieser Punkte fühlen wir uns heute darin bestätigt, dass das Haus auf dem richtigen Weg ist. Wir haben einige Jahre später, 2010, ein zweites Peer-Review-Verfahren zu der Frage durchgeführt, wie sich das, was die Landesregierung entschieden hat, nämlich eine Auftrennung von Versuchsschule und Wissenschaftlicher Einrichtung, eigentlich bewährt. Diese Trennung ist etwas, was uns oktroyiert worden ist, etwas, was sowohl der Kollegleiter als auch der wissenschaftliche Leiter so nicht angedacht hatten, was auch nicht im Gutachten vom 2004/5 stand. Das ist etwas gewesen, was das Land Nordrhein-Westfalen für das Oberstufen-Kolleg entschieden hat, ausgehend vom Hochschulfreiheitsgesetz, das damals H. Pinkwart (FDP) angeregt hatte. Das Gesetz hat alle Einrichtungen, die die Universitäten rundherum in den siebziger Jahren entworfen und als Satelliten gegründet hatten, auf den Prüfstand gestellt und viele davon abgeschafft. Wir sind glücklicherweise nicht abgeschafft, sondern »nur« in unserer Grundkonstitution geändert worden, und das war ein schwieriger Umstellungsprozess, den wir gemeinsam leisten mussten. Alle Mitarbeiter mussten ertragen, dass sie nicht mehr »Dozenten« und »wissenschaftliche Mitarbeiter« eines Kollegs waren, sondern zu »Lehrern« gemacht wurden.
Wir haben in achtzig erregte Gesichter gucken dürfen, die dem Prozess nicht zugestimmt haben. Aber es gab keine Alternative! Uns wurde von der Politik gesagt: Entweder ihr macht das oder es gibt euch nicht mehr! Das war wirklich eine Friss- oder Stirb-Politik. Dass wir uns nach dem Oktroy trotzdem als Versuchsschule und als abgetrennte wissenschaftliche Einrichtung in kurzer Zeit wieder erholt haben, dass die Arbeit auch in dieser schwierigen Phase weitergelaufen ist, das ist erstaunlich. Wir haben zum Beispiel in dieser Zeit vier Forschungs- und Entwicklungsprogramme (FEPs)durchgeführt. Dass das schulpraktisch-wissenschaftlich erhalten blieb, ist für mich eine Bestätigung dafür, dass die Kreativität in diesem Hause auch in schwierigen Situationen erhalten geblieben ist, und das beste Beispiel dafür ist, dass wir uns 2009 dafür entschieden haben, zu sagen: »Wir machen mit beim Deutschen Schulpreis!«, um ihn dann 2010 auch zu erhalten.
Es schon 2006 zu probieren, das wäre sehr gewagt gewesen. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch mitten in der Krise. Da wusste noch niemand, wohin das Ganze gehen würde.
Wo stehen wir also heute? Sieben Jahre – habe ich gesagt – bin ich hier in Bielefeld. Ich glaube, das Oberstufen-Kolleg ist erstmals gesichert, das war unsere Hauptaufgabe. Mal gucken, wie es weitergehen kann. Wir haben viele spannende Forschungsprojekte durchgeführt und jetzt lassen wir uns noch einmal durch eine Peer-Review-Group beraten: Wohin soll es eigentlich zukünftig gehen? Wir erwarten, dass uns im neuen Peer-Preview-Verfahren weit reichende Empfehlungen gegeben werden.
Wenn man sich die Schulstruktur anschaut, dann geht es nicht nur darum, die Gymnasien weiterzuentwickeln, sondern auch darum ein weiteres Projekt des Landes zu realisieren, die Reform des gegliederten Schulwesens. Es geht darum, eine zweite Säule zu finden – sei sie wie in Hamburg Stadtteilschule oder wie in Nordrhein-Westfalen Gemeinschaftsschule genannt -, in der Schülerinnen und Schüler in einem Lehrgang, der nicht dem gymnasialen Lehrgang folgt, zum Abitur geführt werden. Für die Klientel dieses zweiten Weges – glaube ich – kann das Haus seinen Beitrag leisten. Wir können – auch für eine andere Schulformen wegweisend – unser Programm weiter entwickeln. Das könnte eine Empfehlung der Peer-Review-Group sein.
Wir sind zugleich gespannt auf andere Empfehlungen. Da sitzen doch kreative Geister in dieser Kommission, acht Personen, die uns jetzt gerade beraten. Sie werden im Frühjahr 2011, das, was sie hier in einer zweitägigen Begehung gesehen haben, darstellen und uns Vorschläge für die weitere Entwicklung des Oberstufen-Kollegs machen. Das können aber natürlich nur Vorschläge sein. Denn wir selbst müssen entscheiden, was wir tun wollen. Aber wir lassen uns gern beraten. Das haben wir beim letzten Mal so gemacht und das machen wir jetzt auch wieder.
H. Kroeger:
Ich möchte noch eine Anmerkung machen. In den letzten 4,5,6,7 Jahren mussten
wir große Probleme bewältigen, darunter die Aufforderung der Landesregierung,
dass das Oberstufen-Kolleg auch am Zentralabitur beteiligt sein sollte. Josef
Keuffer und ich haben dem sehr früh zugestimmt, da wir es für strategisch gut
hielten. Wenn wir an andere Schulen kommen und von unseren – wie auch
immer gearteten – Unterrichtserfahrungen und -ideen sprechen und die
Lehrerinnen und Lehrer dafür gewinnen wollen, werden sie nachfragen: »Habt
ihr denn auch zentrale Abiturprüfungen?«. Und wenn wir »Nein« sagen, dann
sagen diese Kolleginnen und Kollegen sofort: »Ja, dann könnt ihr ja schöne
Ideen entwickeln und andere Sachen machen.... Wir müssen aber am
Zentralabitur teilnehmen.«
Wir gehen davon aus, dass es eine größere Effektivität und Glaubwürdigkeit hat, wenn wir am Zentralabitur teilnehmen und trotzdem gute andere Unterrichtsformen entwickeln können. Deswegen nehmen wir seit 2008 am Zentralabitur teil. Dafür mussten fast alle Curricula von oben bis unten neu geschrieben werden; und auch die Unterrichtsformen und die Art des Lernens sind anders geworden. Allerdings nicht so, wie wir es eigentlich wollten. Denn das jetzt Praktizierte ist leider doch nur ein teilweise ziemlich ordentliches Hinführen der Kollegiaten auf eine vorgeschriebene Abiturform, die nicht so anspruchsvoll ist, wie wir sie vorher gehabt haben.
Anzumerken ist, dass es auch eine Entlastung darstellt, dass man die Abituraufgaben nicht mehr selber machen muss. Die zentral vorgegebenen Abituraufgaben sind für uns »machbar«, und wir haben bisher ziemlich gut dabei abgeschnitten. Insofern ist das auch wieder eine Bestätigung dafür, dass man in Oberstufen anders arbeiten kann; vielleicht sogar noch deutlicher anders, als wir es jetzt tun. Wir können uns einer vergleichenden Lernstandserhebung wie dem Abitur stellen, obwohl wir vorher anders gearbeitet haben. Das würde ich gerne noch stärker akzentuieren. Ich hoffe, dass die Peers noch radikaler schauen, wie man Lern-, Arbeits-, Unterrichts- und Lehrformeln gestalten kann, die ganz anders, aber gleichwertig bezüglich der Vorbereitung der Abiturprüfung sind.
Ch. Görlich:
Ihre Schilderung, wie schwer sich ihre Kollegen taten, als sie plötzlich
weniger Forscher und mehr Lehrer sein sollten, hat mich sehr beeindruckt.
Diese zunächst persönlich tragischen Geschichten möchte ich in allgemeinere
Frage umformulieren: Ist diese Ambivalenz nicht ein Grundproblem unseres
ganzen Bildungssystems, dass wir als Lehrer immer noch nicht ein klares
Berufsbild gefunden haben und es immer noch als Abwertung empfinden, bloß
Lehrer und nicht Forscher zu sein? Diese Idee, Lehrer, werde Forscher, ist
sehr in den Hintergrund getreten, und damit auch die entsprechenden Kontexte,
die Mentalität der Menschen und das überkommene Gesellschaftsbild!
Eine weitere Frage knüpft an ihren Hinweis auf die Forschungspläne an: Was soll da erforscht werden? Was sind z.B. Ihre Beiträge zum Thema individualisiertes Lernen? Wie kann man trotz »Zentralabitur« individualisierte Lernwege organisieren? Da ist doch sicher bei ihnen ein reicher Erfahrungsschatz entstanden.
Weiter wäre zu fragen, wie eigentlich das, was an einer Versuchsschule mit engagierten Mitarbeitern gedacht, erfunden und probiert wird, besser in andere Systeme transferiert werden kann. Das Thema Laborschule/Oberstufen-Kolleg taucht in der Zweiten Phase der Lehrerbildung einmal im Seminar auf. Das war es dann aber auch schon, und das kann doch nicht ausreichen!
J. Keuffer:
Sie bringen jetzt viele Fragen ein. Ich versuche sie der Reihe nach zu
beantworten. Erstens: Was tut die wissenschaftliche Einrichtung? Dazu habe
ich noch nicht hinreichend Stellung genommen. Es ist so, dass wir seit der
Aufteilung in Schule und Wissenschaftliche Einrichtung arbeitsteilig das
Ganze organisieren. Wir haben in der Universität ein Team der
Wissenschaftlichen Einrichtung – es gibt fünf Mitarbeiter, es gibt
Hilfskräfte –, das gemeinsam mit der Versuchsschule einen Forschungs-
und Entwicklungsplan umsetzt. In diesem Plan haben wir zurzeit
15 Forschungsprojekte, früher waren es einmal mehr. Diese
15 Forschungsprojekte laufen jeweils für zwei Jahre und widmen sich
bestimmten Themenstellungen, die ich jetzt nicht im Detail aufführe, aber ich
kann Bereiche benennen, Bereiche der Schulentwicklung, der
Unterrichtsentwicklung, der Qualitätssicherung, des Übergangs von Schule zu
Hochschule und natürlich konkret Bereiche der didaktischen Arbeit, die
beobachtet und erforscht werden.
Wir sind bei dem Konzept geblieben, dass die Lehrer die eigene Praxis erforschen. Wir haben gegenüber dem von Hentigschen Lehrer-Forscher-Modell, wo der Lehrer seinen eigenen Unterricht erforscht, sogar eine Erweiterung vorgenommen. Wir haben einen Forschungsmix entwickelt. Es geht nicht um die reine Lehrerforschung. Wir haben gleichzeitig Evaluationsprojekte und wir haben Projekte im Haus, die wir als Grundlagenforschung bezeichnen, weil es darum geht, wissenschaftliches Neuland zu betreten – über Dissertationen, über Habilitationen und – da bemühen wir uns gerade noch – über DFG-Projekte. Es geht nicht nur darum, das ganze praktische Wissen zu erforschen, sondern etwas abgehoben, genau wie damals in unserer Video-Partizipations-Studie, die Meinert Meyer auch mit mir zusammen gemacht hat, wo es um die Frage ging: wie eigentlich die Schülerpartizipation im Unterricht zu denken ist? Die Rückmeldung an die Schulen ist damals erst Jahre später erfolgt; als die Schulen längst weiter waren und die Lehrer sich schon gar nicht mehr erinnern konnten, dass sie an dieser Untersuchung teilgenommen hatten. Bei der Lehrer-Forschung geht so etwas nicht. Da muss man zügig Rückmeldung geben, damit sich die Schule weiter entwickelt. Grundlagenforschung ist demgegenüber ein wenig abgehoben.
J. Keuffer:
Wir versuchen diesen Forschungs-Dreier-Mix – Entwicklung, Evaluation
und Grundlagenforschung – im Hause durchzuführen, und das ist hoch
anspruchsvoll, weil wir damit etwas leisten, was die Erziehungswissenschaft
allein nicht geleistet hat und wohl auch nicht leisten will. Wir nehmen alle
methodischen Ansätze der Schul- und Unterrichtsforschung zusammen wahr und
haben damit gute Erfahrungen gemacht.
Man muss die Forschungsansätze jeweils mit den anderen Aufgaben des Hauses vermitteln und die Ergebnisse, die dabei entstehen, auch in die anderen Bereiche übertragen. Diesen Transfer muss man im Hause zwischen den Wissenschaftlern, die auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten, organisieren und die Ergebnisse müssen wir auch nach außen tragen. Fehlender Transfer war früher einmal ein Vorwurf des Wissenschaftlichen Beirats, er kam aber auch aus Düsseldorf: »Das macht Ihr noch nicht so richtig!«.
Inzwischen wissen wir, dass Transfer nicht immer und nicht überall geht. Wenn aber bestimmte Projekte abgeschlossen sind und wir wissen, dass wir etwas Gutes nach außen tragen können, dann tun wir das auch.
Dazu passend gab es einen Vorschlag von Jürgen Oelkers, die Gründung eines Fortbildungs-Departments hier im Hause, an dem wir gezielt Fortbildung in die Studienseminare oder in die Schulen tragen können.
Zum Beispiel zum Thema »Projektarbeit«, wo das Oberstufen-Kolleg viel zu sagen hat, oder zum Thema »fächerübergreifender Unterricht«, oder zu den Naturwissenschaften – das kommt demnächst.
Die von uns entwickelten Basiskurse sind mit Sicherheit auch an andere Schulen transferierbar. Dafür brauchen wir dann aber auch entsprechende Ressourcen, die wir bisher nicht oder nur ansatzweise haben.
H. Kroeger:
Wir machen viel, sind aber immer hinter dem im Rückstand, was wünschenswert
wäre.
J. Keuffer:
Das sind dann die Lehrkräfte, die die Transferarbeit quasi aus
Selbstausbeutung heraus annehmen und weit über den eigentlichen Dienst hinaus
betreiben. Deshalb nehmen wir die Vorwürfe, die von außen gekommen sind,
nicht immer ernst, sondern sagen:
»Okay. Wir können das nur dann leisten, wenn die Fortbildungsaktivitäten auch politisch erwünscht sind.«
Im Moment sind in Nordrhein-Westfalen erst einmal die Kompetenzzentren dran, nachdem das Landesinstitut abgeschafft worden ist.
Wenn es im Haus gelingt, ein Weiterbildungs- und Fortbildungs-Departement aufzubauen, dann können wir das demnächst auch leisten.