
|
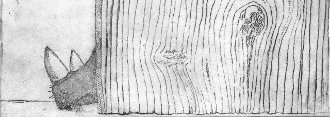
|
Ch. Görlich:
Wie werden am Oberstufen-Kolleg Referendare ausgebildet? Ich könnte mir
mögliche Konflikte zwischen einer Versuchsschule und den »starren«
Ausbildungskonventionen von überfüllten Seminaren vorstellen. Sind
Referendare an den Versuchen beteiligt?
J. Keuffer:
Wir beteiligen uns an der Lehrerausbildung, und wir machen das gern. Wie
viele Referendare es jetzt konkret sind, kann vielleicht der Kollegleiter
besser als ich sagen. Wir haben auch Personen, die als so genannte
Seiteneinsteiger im Hause sind und die dann berufsbegleitend ihr
Referendariat ableisten. Diese Form der Ausbildung gibt es aber in dieser
Intensität erst für die Zeit nach 2000.
Eine Schwierigkeit sehe ich im besonderen Falle des Oberstufen-Kollegs darin, dass ein Referendar hier nur in der Oberstufe unterrichten kann. Er muss dann immer mit einer anderen Schule kooperieren. Denn die Laborschule hat sich dezidiert und bewusst aus der Lehrerausbildung ausgeklinkt, wofür es zwei Argumente gibt: Erstens, man zieht Ressourcen ab, und das wollen sie nicht –; das andere Argument lautet mit den Worten von Annemarie von der Gröben »Die sollen erst einmal an einer ordentlichen Schule das normale Handwerk lernen, bevor sie zu uns in die Versuchschule kommen.« Die Referendare geraten in zu große Konflikte, wenn sie die Auflagen der Laborschule erfüllen und gleichzeitig den Anforderungen eines Studienseminars Genüge leisten sollen.
Wir sehen da für das Oberstufen-Kolleg nicht so große Probleme. Unsere Referendare sind eigentlich alle gut gefahren. Bei uns gibt es nicht diese große Diskrepanz gegenüber der Regelschule, wenn wir zum Beispiel einen Referendar ins Kolleg aufgenommen haben, der nur Oberstufenfächer hat. Das Oberstufen-Kolleg beteiligt sich aber nicht nur über die Ausbildung der Referendare an der Lehrerausbildung. Wir haben inzwischen auch Fachleiter, die hier im Hause sind - zum Beispiel einen Fachleiter für Sport –, die gleichzeitig am Studienseminar Bielefeld arbeiten.
Außerdem haben wir im Rahmen der universitären Lehrerausbildung Fallstudiengruppen im Hause, die hier arbeiten. Wir haben Praktikanten, die aufgenommen werden. Also alle Ebenen der Lehrerausbildung sind auch im Hause vertreten, aber eben nur in beschränktem Umfang. Wir können nicht alle Studierenden und Referendare in das Haus lassen, die es gerne wollen. Die Schule muss sich schützen, sonst erden es zu viele. Deswegen haben wir auch immer nur bestimmte Fallstudiengruppen hier, nur eine begrenzte Anzahl von Praktikanten. Gabriele Obst, die stellvertretende Kollegleiterin, kümmert sich darum, wie viele jeweils aufgenommen werden. Das wird immer jedes Jahr neu entschieden. Wir nehmen so viele, wie es geht, aber auch nicht mehr. Ich finde es realistisch, dass die Schule eine Grenze zieht und sich nicht mehr aufhalst, als sie leisten kann.
Und dann haben wir in Bielefeld natürlich eine hochinteressante und sehr spannende Entwicklung über das neue Lehrerausbildungsgesetz, das demnächst kommen wird. Bielefeld hat ja zunächst - seit 2003/4/5 - einen eigenständigen Weg der Bachelor/Master-Ausbildung genommen. Und jetzt kommt nach der Baumert-Reformkommission und nach dem neuem Lehrerausbildungsgesetz eine ganz andere Variante. Wir müssen uns dafür in Bielefeld kräftig umstellen.
M. Meyer:
Macht ihr jetzt wieder etwas Neues?
J. Keuffer:
Wir machen etwas Neues. Der Modellversuch zur BA/MA-Lehrerausbildung ist
beendet. Die CDU/FDP-Landesregierung hat den Versuch abgebrochen, ohne dass
er jemals evaluiert worden wäre. Das hat uns in Bielefeld verständlicherweise
unglaublich erregt. Die Vorstellung, die das damalige Rektorat der
Universität mit Herrn Timmermann gehabt hat - Umstellung auf das kanadanahe
System – ist überholt und das tangiert nicht nur die Lehrerbildung,
sondern alle Fächer. Alle Studiengänge werden neu akkreditiert. Die gesamte
Studienstruktur musste dafür neu gestaltet werden.
Dahinter verbergen sich zwei Vorstellungen, die ich gern erläutern will. Die Konzeption des kanadischen Modells beruht auf dem Baukastenmodell. Eigentlich ist es egal, wann ein Student ein Modul belegt. Er findet sich in seinem Bildungsgang selber zurecht. Das Modell, was wir jetzt im Lehrerausbildungsgesetz haben und das durch Baumert mit vorbereitet worden ist, basiert dagegen auf einer kumulativen Konzeption, quasi spiralcurricular angelegt. In diesem Modell ist es nicht egal, wann man was studiert. Diese beiden Modelle sind also nicht anschlussfähig. Entweder macht man das eine oder das andere. Jetzt haben wir in Bielefeld genau wie früher wieder drei Fächer im Bachelor Lehramtsstudiengang, drei Fächer im Master: Erstes Unterrichtsfach, zweites Unterrichtsfach und Erziehungswissenschaft. Das war im Bielefelder Modellversuch 2003-2010 deutlich anders, und der Umstellungsprozess wird von vielen in Bielefeld als ein Rückschritt empfunden.
Wir versuchen jetzt aber, da herauszukommen, indem wir noch einmal ganz neu an die Sache herangehen. Bielefeld wird deshalb 2011 eine Bielefeld School of Education gründen. Wie das aussehen wird, kann ich jetzt nur grob skizzieren. Der Bachelor-Studiengang bleibt polyvalent. Er wird nicht schulformspezifisch ausgelegt, aber man schreibt sich in ein Lehramt ein. Denn es gibt viele Überschneidungen zwischen dem Kernfach Erziehungswissenschaft und den verschiedenen Schulformen. Die grundlegenden Veranstaltungen gelten für alle Lehramtsstudiengänge gleichermaßen, zum Beispiel hinsichtlich der Thematik »Einführung in die Forschungsmethoden«. Zugleich gibt es aber einen sehr spezifischen Master. Dieser Master wird von der Bielefeld School of Education und nicht mehr von den Fakultäten verantwortet.
Die Fakultäten sind damit aber nicht einverstanden. Sie merken, dass man ihnen etwas wegnimmt. Das ist also ein ordentliches Reformprogramm, das wir hier in Bielefeld zu bewältigen haben. Wir sind außerdem mitten im Prozess der Abstimmung mit den Studienseminaren, die die Lehrerausbildung mit uns in Kooperation betreiben müssen. Das Praxissemester des MA-Studiengangs fängt gerade erst an.
Wie wichtig das ist, verdeutlichen drei Tagungen zur Lehrerbildung, die heute statt finden. In Wuppertal spricht man über das Praxissemester, in Münster tagt die GEW zusammen mit dem Ministerium über die Ausrichtung der Lehrerbildung und in Bielefeld tagen wir heute zum Thema Portfolio in der Lehrerausbildung.
Ch. Görlich:
Das jetzt abgewickelte Bielefelder Modell lief nach dem kanadischen Muster
und gab den Studierenden mehr Freiheit in dem Sinne, dass sie individuelle
Wege gehen konnten? Sehe ich das richtig? Es ist für Sie bezüglich dieses
Punktes vielleicht eine interessante Information, dass ich als Seminarleiter
angesichts der vielen Ausbildungsjahrgänge und der heterogenen
Voraussetzungen in der Referendarausbildung versucht habe, gleichfalls ein
Baukastensystem einzuführen. Es war aber nicht durchsetzbar, weil viele
Kollegen befürchteten, ohne die kumulativen Verbindlichkeiten ihre
Referendare zu verlieren. Ich finde es spannend, dass auch Sie es wieder
versucht haben! Man wird das Geschehen aufmerksam verfolgen.
J. Keuffer:
Ich bin in der Beratergruppe des Rektorats zum Aufbau der BiSEd, der
Bielefeld School of Education. Das BiSEd ersetzt zwangsläufig das ZfL, das
Zentrum für Lehrerbildung, und wird größere Kompetenzen erhalten. Aber es
bedarf noch eines weiteren Abstimmungsprozesses mit den Fakultäten und den
Studienseminaren, bevor dies Wirklichkeit wird.
Ch. Görlich:
Soweit mir die Publikationen von Ihnen, Herrn Keuffer, zur Lehrerausbildung
in Erinnerung sind, haben sie immer die besondere, Sinn gebende Bedeutung
einer phasenübergreifenden Ausbildung betont. Könnte eine solche Zielsetzung
durch die BiSEd eher erreicht werden?
J. Keuffer:
Es gibt durchaus Bestrebungen, sich gegenseitig zu stützen und zu fördern,
zum Beispiel indem in einem Vorstand der Bielefeld School of Education ein
Mitglied der Studienseminare sitzt und indem umgekehrt nach entsprechenden
Institutionalisierungen in den Studienseminaren gesucht wird. Die Universität
will aber hier im Moment noch gar nicht einsteigen. Denn solche
Verflechtungen bedeuten einen Eingriff in ihre Autonomie. Die Studienseminare
wissen ihrerseits auch selber nicht, wie sie mit den neuen Zentren für
Lehrerausbildung kooperieren sollen. Also da ist viel Bewegung im Ganzen. Ob
diese Abstimmungsprozesse dann gelingen, hängt auch von den Personen ab, die
in den verschiedenen Einrichtungen tätig sind.
Ch. Görlich:
Da sagen sie wohl etwas Wahres und leiten schon zu meinen weiteren Fragen
über. Die Schwierigkeiten - bitte entschuldigen Sie Trivialität! - liegen
bekanntlich im Detail, im finanziellen, im personellen und konzeptionellen
Bereich. Was ich noch einmal formal und auf der Meta-Ebene zu bedenken geben
möchte und was wir aus Praktikerperspektive viel zu wenig in den Blick
nehmen, ist die Frage: Was solche Reformen eigentlich kosten? Dabei denke ich
nicht nur und in erster Linie an das Geld, sondern auch an die Zeit, das
eingesetzte Engagement und die weiteren Resourcen. Steht dieser Einsatz in
einem angemessenen Verhältnis zum Erfolg? Wenn ich daran denke, wie viele
Tagungen wir im Kollegium unseres Studienseminars gemacht haben, z.B. zur
Portfolioarbeit, wie viele unterschiedliche Meinungen es dazu gab, zum
Beispiel ob das Portfolio selbst verantwortet oder kontrolliert werden sollte
etc., und wenn ich dann schaue, was dabei effektiv als Mehrwert der
Ausbildung herausgekommen ist, dann hätte ich ganz gern einmal empirisch und
qualitativ überprüft: Lohnt sich das überhaupt diese ganze Arbeit?
J. Keuffer:
Das wird man wohl nicht empirisch messen können. Man müsste den Aufwand, den
man hat, in Relation zu dem Ertrag der ganzen Innovation setzen. Das ist sehr
schwierig. Eine solche Abwägung schaffen noch nicht einmal die Unternehmen in
der freien Wirtschaft. Die Unternehmen arbeiten mit Unternehmensberatungen,
die alle 4-8 Jahre ihr Vokabular austauschen, weil sie die Menschen auf Trab
bringen wollen. Das geht im Schulbereich, in der Erziehung so nicht. Da ist
immer noch ein Ethos dahinter. Wir haben einen übergreifenden
Bildungsbegriff. Deshalb kann man nicht einfach eine Reform nach der anderen
durch das Dorf treiben.
Die Reformvorhaben der Bildungspolitik sind derzeit schneller als die Empirie und die Schule. In den siebziger Jahren war dagegen die Politik langsamer. Da ist sie nicht dem nachgekommen, was Wissenschaft und Schule gedacht haben. Die Bildungspolitik möchte alles immer sofort umgesetzt wissen. Wenn dann die nächste PISA-Studie kommt und zeigt, dass der gewünschte Lernerfolg immer noch nicht eingetreten ist, dann soll die Schule wieder ranklotzen, aber das überfordert die Menschen.
Ein Beispiel: Die Standards in den einzelnen Fächern so zu erstellen, dass sie nachher empirisch messbar sind, diese Arbeit ist zu großen Teilen noch nicht geleistet. PISA hat die Standardisierung für die Fünfzehnjährigen vielleicht für einige Bereiche geleistet, wir haben sie aber noch nicht für das Abitur. Hier gibt es immer noch nicht in allen Fächern kompetenzorientierte Standards. Es gelten nach wie vor die lernzielorientierten Richtlinien.
Solange dies so ist, sollte man nicht mit der Anforderung eines bundesweit vergleichbaren Abiturs auftreten. Bildungspolitik sollte im Moment eigentlich einmal locker lassen, die Menschen in Ruhe lassen und die Reformversuche, die laufen, zu Ende zu bringen. Wir haben die Lehrerbildungsreform in Bielefeld 2003-2010 durchgeführt, und jetzt muss das gesamte System wieder neu umgestaltet und neu akkreditiert werden. Dabei ist jede Akkreditierung ein Riesenakt. Ein Zyklus von 5 bis 7 Jahren für derartige Reformen ist viel zu knapp bemessen.
Ch. Grlich:
Obwohl ich nur mit einem gewissen Vorbehalt in ökonomischen Kategorien
spreche, kann ich wohl mit gutem Gewissen, darauf hinweisen, dass es manchmal
Anfangsinvestitionen braucht, die sich vielleicht erst Jahre später
auszahlen. Ich denke an die Computertechnologie, für die empirisch
nachgewiesen ist, dass am Anfang viel Zeit investiert werden muss, um
hinterher eine Erleichterung bei Routinearbeiten zu erreichen. Ich möchte
deshalb auch im Namen unseres nicht anwesenden Kollegen, Herrn Professor
Ludger Humbert, eine abschließende Frage zu den Informationstechnologien am
Oberstufen-Kolleg stellen. Was mich immer wieder ärgert ist, dass in der
öffentlichen Wahrnehmung die neuen Informationstechnologien schlichtweg auf
Technologien reduziert werden, obwohl wir, Ludger Humbert und auch ich, darin
eine zentrale Bildungsaufgabe sehen. Da eröffnen sich nicht nur technische,
sondern auch ethische, ästhetische, ökologische und sogar metaphysische
Fragen. Inwieweit ist dieses medienpädagogisch äußerst komplexe Gebiet am
Oberstufen-Kolleg in den Blick genommen?
J. Keuffer:
Ich glaube, dass sich das Haus dieser Aufgabe in besonderer Weise stellt,
insofern die informatische Grundbildung, die wir hier am Oberstufen-Kolleg
haben, als eine weitere »Sprache« in den Blick genommen wird und eben dort
ein Basiskurssystem geschaffen worden ist, in dem alle Kollegiaten mit dieser
Basistechnik konfrontiert werden. Das kriegt man nicht mit einem Fach
Informatik hin, sondern nur querliegend mit einer informatischen Bildung, die
wir als Basisprogramm bezeichnen. Das ist etwas anderes als ein Fach
Informatik, in dem dann auch die von Ihnen genannten ethischen
Fragestellungen kombiniert mit technologischen Fragen vorkommen.
Ch. Görlich:
Wir sprechen hier eher geringschätzend von »Produktschulung«.
J. Keuffer:
Da sind wir uns einig, durchaus auch in der kritischen Sicht auf die neuen
Medien. Allerdings nicht so kritisch wie Hartmut von Hentig, der sehr
ablehnend auf die neuen Informationstechnologien reagiert hat. Wir haben sie
nicht abgelehnt. Wir sagen vielmehr: Es handelt sich um eine neue
Kulturtechnik, die jungen Menschen sind damit befasst, und wir dürfen diese
Kulturtechnik nicht ablehnen, sondern müssen mit ihr arbeiten. Das tun wir
auch. Die technische Ausstattung unserer Schulen entspricht dieser Haltung.
Sie ist ziemlich gut.
Ch. Görlich:
Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.