
|
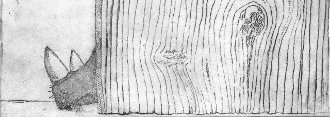
|
Zu Beginn des Jahres 2009 erschien im Reclam Verlag ein kleines Büchlein, dem die gebührende Beachtung in der Lehrerbildung zu wünschen ist: die Einführung in die Didaktik von dem in Münster lehrenden Ewald Terhart. Wie von einem Leuchtturm wird hier der Weg durch ein äußert artenreiches didaktisches Biotop gewiesen – durch Begriffe, interdisziplinäre Bezüge, prominente Theorien und Modelle. Terhart beleuchtet dabei aber nicht nur die etablierten Theorielinien; er lenkt vor dem Hintergrund seiner offensichtlichen Praxiskenntnis auch den Blick für die »Eigentümlichkeiten, Selbstfixierungen und stabilen Blindstellen« – nicht nur in den Auen der Hochschullandschaft, sondern auch in der dünneren Luft der zweiten Phase der Lehrerbildung.
Eigentlich befinde sich nach Terhart die Allgemeine Didaktik als ein spezieller Wissensbereich der Erziehungswissenschaft in einer komfortablen Lage: in Prüfungs- und Ausbildungsordnungen verankert und durch renommierte Lehrbücher in ihrem Wissensbestand etabliert, könnte von einer Erfolgsgeschichte der Allgemeinen Didaktik gesprochen werden. Jedoch sieht Terhart in dieser Kanonisierung auch bedenkliche Erstarrungstendenzen – bedenklich angesichts der herausfordernden Diskurse über die Fachdidaktiken, über die Universalisierung des Didaktikbegriffes, über das informelle Lernen und/oder über die Diversifikation der Lernwelten durch die Informationstechnologien:
»Die Theorielage hat sich seit Jahren – wenn nicht Jahrzehnten – kaum geändert. […] Womöglich erschweren sogar die institutionelle Absicherung in der Lehrerbildung und die damit verbundene Kristallisation eines ehedem lebendigen theoretischen Zusammenhangs zu immer wieder durch genommenen Lehr- und Prüfungsstoff eine selbstkritische Sichtweise; vielleicht wird gerade dadurch innovatives Potenzial blockiert. So drängt sich der Verdacht auf, dass die allgemeine Didaktik womöglich am eigenen institutionellen Erfolg erstickt ist« (Ewald Terhart, Didaktik. Eine Einführung, Stuttgart 2009, S. 192).
Dies sind für die zumeist in verbeamteten Strukturen wirkenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lehrerbildung offene und deutliche Worte, die viel Zustimmung finden dürften. Aus welchen Quellen könnte sich ein Aufbrechen dieser Blockaden speisen? Das innovative Potenzial – gleichsam die Erbschaftsanwärter der konventionellen Allgemeinen Didaktik – sieht Terhart in den drei Diskussionsdomänen:
Der Zugewinn durch die fachliche Lehr- und Lernforschung, durch die Wende zur Empirie allgemein, ist nicht zu unterschätzen. Terhart zitiert eine respektable Untersuchung, wonach der stärkste, für das kognitive Lernen förderlichste Effekt des Unterrichtens von der Fachspezifik ausgehe (a.a.O. S.196). Doch die berufliche Kompetenz einer Lehrerin und eines Lehrers erschöpft sich nicht in Fachkenntnissen und fachdidaktischen Fähigkeiten. Deshalb – so Terharts Schlussfolgerung – kann auch eine voll ausgebildete fachdidaktische Lehr- und Lernforschung allein nie die hinreichende Basis für die qualifizierte Ausübung des Lehrerberuf sein, »weil dieser zwar im Kern aus Unterrichten besteht, hierin aber natürlich nicht aufgeht«.
Das so genannte Abarbeiten der Bildungsstandards bindet gegenwärtig so viel Zeit und Kraft in der Lehrerausbildung, dass der Ruf, sich wieder mehr auf die konkrete Arbeit vor Ort in der Schule zu besinnen, immer häufiger erschallt. Nicht nur Terhart wird durch die Diskussion um die Bildungsstandards an die Curriculum- und Unterrichtsreformabsichten der frühen 1970iger Jahre erinnert.
»Aber wie schon vor 30 Jahren besteht die Gefahr, dass schulisches Lehren und Lernen nicht anhand der Antwort auf Begründungs- und Inhaltsfragen, sondern vom Ergebnis, also gewissermaßen: vom Ende her, das heißt von den Chancen und Möglichkeiten der testdiagnostischen Erweisbarkeit (Aufzeigbarkeit und Beurteilbarkeit) von Lernergebnissen und Kompetenzniveaus her gestaltet wird« (a.a.O. S. 200).
Das Herunterbrechen der Bildungsstandards in den konkreten Unterricht steht in der Gefahr, im bekannten Formalismus der ehemaligen Lernzieldimensionierungen und -hierarchisierungen zu erstarren. Bei aller Anerkennung der systemischen Notwendigkeit, Schulsysteme normativ zu regulieren, besteht wie einige Jahrzehnte zuvor die Gefahr, dass diese Reformbemühungen die lehrenden und lernenden Subjekte vor Ort in den Schulen ausblenden und nicht erreichen.
Angesichts der begrenzten Reichweite dieser beiden Ansätze und auch ihrer Gefahrenpotentiale verspricht sich Terhart dialektisch folgernd am meisten von einem Ansatz, der es versteht, empirische, normative und operative Ebene zu verknüpfen. In diesem Sinne setzt Terhart seine Hoffnungen auf die Bildungsgangsforschung: »Die /Biografisierung des Bildungsproblems/ ist der entscheidende Gedanke, der durch diese Gruppe [der Bildungsgangforschenden] in den Argumentationshaushalt der bildungstheoretischen Didaktik eingebracht wird. Das Bildungsdenken wird damit erneut aus der Sphäre des Spekulativ-Normativen heraus an die ablaufenden Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Heranwachsenden gekoppelt – ohne dabei in empirische Entwicklungs- und Biografieforschung aufzugehen« (a.a.O. S.202).
Angesichts des Renommees von Ewald Terhart dürfte sich ein Lehrerseminar also wohl in guter Gesellschaft befinden, wenn es die Bildungsgangsforschung auch unter dem Gesichtspunkt befragt, inwieweit sich die dort entwickelten Überlegungen auch als Ausbildungsparadigma eignen.
Das große staatliche Interesse an der Steuerung der Lehrerausbildung hat dazu geführt, dass die Ausbildung vor allem in der zweiten Phase, dem so genannten Referendariat, in eine hierarchische Struktur eingebunden bleibt und sich nicht wie in der ersten Phase an der Universität eher in autopoetischen Strukturen entwickeln kann. Dabei ist es angesichts der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland schwierig verallgemeinerungsfähige Aussagen zu machen; allerdings dürften gewisse Entwicklungstendenzen, wie sie in NRW beobachtbar sind, auch bundesweit auszumachen sein: die zunehmende Beschleunigung in der Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die zunehmende Rekrutierung von Lehrerinnen und Lehrern auch aus ursprünglich nicht pädagogischen Professionen, die Gefahr einer Entsubjektivierung der Ausbildung durch die Zwänge einer ständig komplexer werdende Institution (etwa bei Häufung von Einstellungsterminen), etc.
Eine differenzierte Darstellung wurde von uns bereits an anderer Stelle vorgenommen: »Die zweite Phase der Lehrerbildung« in: Koubek, Jochen (Hrsg.): IT-Bildungssystem in Deutschland (Arbeitstitel) – noch nicht erschienen – Vorabveröffentlichung (Preprint): www.ham.nw.schule.de/pub/bscw.cgi/d1077529/2008-03-24_IT-IF-Lehrerbildung-2tePhase_Preprint.pdf
Angesichts solcher Entwicklungen und hierarchischen Einbindungen, die ein Gelingen der Lehrerbildung eher unwahrscheinlicher erscheinen lassen, ist es umso erfreulicher zu beobachten, wie trotzdem immer wieder neue Generationen von Lehrerinnen und Lehrern engagiert und mit sichtlicher Freude an ihrer Arbeit in die Schulen hineinwachsen.
Diese Sätze könnten hilfreich sein, um das Veränderungspotenzial der Bildungsgangforschung wirklich würdigen zu können – ein Veränderungspotenzial, von dem ich mir nicht sicher bin, dass es in der staatlichen Lehrerbildung auch immer so gewollt wird. Ich verweise in einem Zitat auf Meinert Meyer selbst, in dem die hier geäußerte Kritik an einer bloß an Richtlinien orientierten und vorwiegend affirmativen Ausbildung auf den Punkt gebracht wird – wohl in Anspielung auf die hoch reflektierte Transformationsdidaktik von Helmut Peuckert (Helmut Peukert, Reflexionen über die Zukunft von Bildung, in: Zeitschrift für Pädagogik 46 (2000), H. 4, S.507–524): »Erziehung ist die Summe der Reaktionen einer Gesellschaft auf die Tatsache des menschlichen Lernens. Bildung ist mehr. Sie basiert auf Freiheit und Selbstbestimmung. Die Förderung von Bildung bedarf deshalb einer Kultur, die nicht nur die Reproduktion der Gesellschaft sichert, sondern zugleich gesellschaftliche Transformation ermöglicht«
(vgl. den Beitrag »Was ist eigentlich Bildungsgangforschung?« von Meinert Meyer).
Es geht also auf der normativen Ebene um Transformation, aber nicht um eine beliebige, sondern um eine Transformation, in der alle Beteiligten angehalten sind, diese in den Bandbreiten der Humanität zu gestalten. Ich verkneife mir, hier das eigentlich nach Richard Rorty angebrachte ironische Augenzwinckern zu erläutern.
Meinert Meyer hat diesen Gedanken der Transformation in einem aktuellen Beitrag weiter entwickelt und durch autobiografische Reflexionen plausibilisiert (vgl. Das lernende Subjekt. Aufsätze. Feschrift zum 65. Geburtstag von Christian F. Görlich, hg. v. Christopher Görlich, Norderstedt 2009, S. 83–150). Gebildet ist nach Meinert Meyer, »wer sich selbst sein Welt- und Selbstbild erarbeitet hat, wer Menschenkenntnis, Urteilskraft und Kritikfähigkeit erworben hat und wer dabei die moralischen Standards der Nichtübervorteilung der anderen berücksichtigt. Gebildet ist wer mit Ungewissheiten umgehen kann, die das Leben bringt. Dies schließt ein, dass die Lehrenden sich darum bemühen, das kulturelle Erbe zu vermitteln. Es verlangt aber den Respekt vor der Individualität der Heranwachsenden« (a.a.O. S. 138).
Anknüpfend an erste Thesen, dass Bildungsgangsdidaktik sowohl zurückblickend als auch vorausschauend denke, erinnert sich Meinert Meyer an die Erziehungsbemühungen seiner Großmutter und seiner Mutter und bezieht dabei seine eigenen recht jungen Erfahrungen als Großvater mit ein. Großmutter, Mutter und er selber dachten und denken bei der Erziehung jeweils in Kategorien, die durch die Ereignisse der Geschichte immer wieder infrage gestellt wurden und werden. Damit veranschaulicht er ein Kernproblem jeder Generationenbegegnung: »Wir wissen nicht, was zukünftig für die Ablieferung der Heranwachsenden in den großen Lebensgemeinschaften erforderlich sein wird. Wir können darüber nur spekulieren. Wir müssen also hypostasieren, dass wir wissen, was die nachwachsende Generation braucht, obwohl wir wissen, dass wir es nicht wissen können!« (a.a.O. S.146)
Etwas salopper formuliert Meinert Meyer an anderer Stelle: »Lehrpläne waren immer von gestern« (a.a.O., S. 150, Anm. 38). Wie können wir in einer solchen Situation als Lehrerinnen und Lehrer handlungsfähig bleiben? Für Meinert Meyer lautete die resümierende Antwort: »Obwohl ich weiß, dass mein Enkelkind in einer ganz anderen Welt leben wird als in der, die ich kenne und die ich mir vorstellen kann, und obwohl ich weiß, dass meine Großmutter mich in ihrem Sinne erziehen wollte, was ich abgefedert habe, werde ich versuchen, mein Enkelkind zu belehren, zu unterrichten, ihm Dinge beizubringen, es zu beeinflussen, einfach weil das Spaß macht, weil ich weiß, dass Geschichten vorlesen für Kinder gut ist, weil das Enkelkind es selbst will. Ich weiß also, dass ich ganz gewiss nicht wissen kann, was von meinen Enkelkind in 50 Jahren gefordert wird, und trotzdem erziehe ich es, wenn es beim mir und meiner Frau zu Besuch ist. Ich versuche zumindest, es zu erziehen. Ich kann gar nicht anders, und obwohl ich schon jetzt sehe, dass es sehr klare Vorstellungen darüber hat, was es will und was es nicht will. Und was für mich und mein Enkelkind gilt, gilt auch für die Schule. […]
Guter Unterricht muss dazu führen, dass die Heranwachsenden in ihrem Bildungsgang unterstützt werden, der anders als unser eigener Bildungsgang ist. Dies heißt, dass man im Unterricht die Bildung der Schülerinnen und Schüler nur dann unterstützen kann, wenn auch sie ihren Bildungsgang in den Unterricht einbringen können, einen Bildungsgang, der ihnen nicht einfach so bewusst ist und für den gleichfalls diffus bleibt, was familiär und gesellschaftlich vorgegeben ist und was der eigenen Freiheit entspringt. Guter Unterricht setzt deshalb voraus, dass die Lehrenden ihren eigenen Bildungsgang kennen« (a.a.O. S. 146f).
Was hier für die Ebene der Schule behauptet wird, dürfte wohl auch für die Ebene der Lehrerausbildung gelten.
Allgemeine Formulierungen sind bekanntlich leichter zustimmungsfähig. Wie aber können wir dieses zunächst eher allgemeintheoretische Konzept der Bildungsgangdidaktik auf die konkrete Praxis im Seminar und in der Schule herunterbrechen? Meinert Meyer selbst hat auf diese Frage auf den von ihm vorgeschlagenen Katalog von Gütekriterien verwiesen (vgl. Meinert Meyer: Unterrichtsplanung aus der Perspektive der Bildungsgangsforschungs. In: Perspektiven der Didaktik – ZfE Sonderheft 9/2008, S. 121ff). Aus der Perspektive eines ehemaligen Seminarleiter möchte ich ihm gerne darin folgen, dass die Reflexion dieser Kriterien nicht nur in der Hochschulforschung, sondern auch im Lehrerseminar ein Königsweg sein könnte, die Aufgabe der oben gekennzeichneten Generationenbegegnung zu gestalten.
Das Stichwort Gütekatalog sollte dabei nicht vorschnell mit dem Verdikt der Zeitgeisthörigkeit belegt werden. In der Vielzahl der gegenwärtig gehandelten Gütekataloge – als Beispiel seien nur der Katalog vom Zwillingsbruder Hilbert Meyer und der von Andreas Helmke erwähnt – ist m.E. jedoch nicht eine marktbedingte Differenzierung der Oberflächenstruktur einer zur Zeit gut gehenden pädagogischen Ware zu sehen, sondern in der nicht ohne Verlust hintergehbaren Vielzahl der Kataloge spiegeln sich nur die Komplexität und Ansprüche des pädagogischen Praxisfeldes. Die Phänomenologie der Aufmerksamkeit hat uns gelehrt, wie vielfältig Komplexität in den Blick geraten kann und auch wohl auch sollte. So gesehen geht es in der Diskussion von Unterricht in der Regel auch gar nicht um die Frage ob alt oder neu, sondern um pragmatisch angesagte Perspektivenwechsel, alternative Fokussierungen, intensivierte oder breitere Wahrnehmungen. Waldenfels (Phänomenologie der Aufmerksamkeit, Frankfurt am Main, 2004) bietet hier viele weitere bedenkenswerte Anregungen.
In diesem Sinne sollten die Gütekriterien von Meinert Meyer für Fachleute keine grundsätzlich neuen und bisher in der Lehrerausbildung noch nicht berücksichtigten Aspekte aufweisen. Allerdings dürfte es für die Lehrerausbildung nur ein Gewinn sein, unter der oben angegebenen normativen Zielvorstellung einer Transformationsermöglichung bestimmte Momente wieder genauer und konsequenter in den Blick zu nehmen.
Dabei wird auf mehreren Ebenen zu arbeiten sein. Zum einen wäre zu überlegen, wie die Ebenen des subjektiven und objektiven Bildungsganges über Entwicklungsaufgaben konsequenter und nachhaltiger vermittelt und institutionell abgesichert werden könnten – und zwar sowohl im schulischen Unterricht als auch in der Referendarausbildung selber. Hier wären die bekannten Stichworte der selbstreflexiven Ausbildungsmomente wieder aufzugreifen – etwa das Stichwort des Portfolio mit allen seinen binnendifferenziellen Möglichkeiten vom Berufseingangsinterview über das Reflektieren von Entwicklungsaufgaben etc. Für konzeptionelle Überlegungen und ihrer institutionelle Implementation braucht man bekanntlich auch in anderen Lebensbereichen viel Ausdauer und Zeit. Aber schon morgen könnte in den Lehrerseminaren die Reflektion der Gütekriterien im Sinne von Meinert Meyer begonnen – Entschuldigung! – bzw. intensiviert werden.
An drei ausgewählten Beispielen sei abschließend aufgewiesen, in welche
Richtung dieses didaktische Denken gehen könnte:
1. Kopplung der Entwicklungsaufgaben der Lehrer und der
Schüler
Als erstes Gütekriterium nennt Meyer die »Kopplung der Entwicklungsaufgaben
der Lehrer und der Schüler«. Dieses Kriterium unterstellt nicht nur, dass
auch ein Lehrer sich lebenslang Entwicklungsaufgaben gegenübersieht –
eine theoretisch sehr einsichtige, fast triviale, aber erfahrungsgemäß
praktisch sehr schwer zu realisierende Herausforderung – sondern dieses
Kriterium könnte auch dazu zwingen, einmal die etablierte – auch
schriftliche – Planungspraxis dahin gehend zu überprüfen, auf welcher
Ebene diese Kopplung eigentlich explitzit dargestellt, geübt und gefestigt
wird. Das würde in der Konsequenz bedeuten, die Planung von ihrer
Produktorientierung an der zu haltenden Unterrichtsstunde mehr auf den Prozeß
der Ausbildung und des Unterrichts auszurichten.
2. Ausbalancierung der Bearbeitung der Entwicklungsaufgaben und der
Verpflichtung auf Allgemeinbildung und Bildungsstandards
In einem zweiten Kriterium nennt Meyer die »Ausbalancierung der Bearbeitung
der Entwicklungsaufgaben und der Verpflichtung auf Allgemeinbildung und
Bildungsstandards«. In einem Seminar, das sich in NRW »Seminar für Gymnasium
und Gesamtschule« nennt, stellt sich etwa immer wieder das Problem, in der
Ausbildung beide Schulformen in einer nicht diskriminierenden Weise
angemessen zu berücksichtigen. In der Praxis führte das häufig zu einem
Additivum etwa unter der thematischen Überschrift
»Unterrichtstörungen II«. In dem o.a. Kriterium hätten wir eine
gemeinsame, Schulformen übergreifende, nicht triviale und nicht
diskriminierende strukturelle Problemstellung. Auch hier stellt sich eine
ähnliche Frage ein, wo denn in den etablierten Planungsformen diese
Ausbalancierung von subjektivem und objektivem Bildungsgang in der
Verlaufsplanung bzw. in der Begründung ausgewiesen wird.
3. Sinnkonstruktion als Basis für Kompetenzentwicklung und
Identitätsbildung
Als letztes Beispiel sei die »Sinnkonstruktion als Basis für
Kompetenzentwicklung und Identitätsbildung« genannt. Hier sei nur daran
erinnert, dass der Begriff der Sinnkonstruktion bewusst als hermeneutischer
Begriff eingeführt wurde, als Konkurrenzbegriff zu dem psychologischen
Begriff der »Motivation«, einem Begriff, der sich nicht immer vom
Manipulationsverdacht freimachen kann. Gerade dieses letzte Beispiel dürfte
für die Biographisierung in der Schule und im Seminar ein entscheidender,
wenn nicht der entscheidende, Gesichtspunkt sein.
In der Folge von der von Terhart nachgezeichneten Entwicklung ist zu bedenken, dass im akademischen Raum zu den o.a. Fragenstellungen der Bildungsgangdidaktik intensive Forschungsanstrengungen unternommen werden. Angesichts der zu erwartenden engeren Kooperation zwischen der ersten und zweiten Phase der Lehrerbildung, den Hochschulen und Seminaren, scheint es deshalb umso mehr Sinn zu machen, dass auch Lehrerseminare sich mehr mit solchen Fragen beschäftigen, um in Zukunft mit der Hochschule wirklich auf gleicher Augenhöhe sprechen zu können.
Seit Meinert Meyer in seine Habilitationsschrift das Bild eines Rhinozeros eingebunden hat, dürfte dieses Emblem für die Legendenbildung der Schule der Bildungsgangforschung eine gewisse Rolle spielen. Aber diese Geschichte wird ein anderes Mal zu erzählen sein.
Hier seien als letztes für Metaphorologieinteressenten nur einige Alltagsfantasien angemerkt, wie sie sich in unserem Alltagswissen finden lassen:
[Teile dieses Aufsatzes wurden am 19.3.2009 im Rahmen einer Verabschiedung aus dem Seminardienst vorgetragen.]